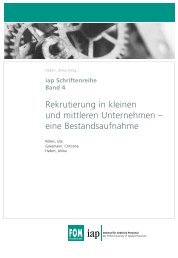Neunstündiger Berufsschultag - Institut Arbeit und Qualifikation
Neunstündiger Berufsschultag - Institut Arbeit und Qualifikation
Neunstündiger Berufsschultag - Institut Arbeit und Qualifikation
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Abschlussbericht<br />
Modellversuch „<strong>Neunstündiger</strong> <strong>Berufsschultag</strong>“<br />
<strong>Berufsschultag</strong> Unterbrechung im Betrieb eingesetzt werden. Der Vorteil wird darin gesehen,<br />
dass Auszubildende bei zweimaligem Fernbleiben vom Betrieb in einer Woche Aufträge nicht<br />
vollständig <strong>und</strong> vor allem nicht termingerecht abschließen könnten. Der dauernde Einsatz<br />
von Auszubildenden im Produktionsprozess ist für die meist kleinen Ausbildungsbetriebe<br />
aber von außerordentlicher Bedeutung für die Wirtschaftlichkeit. Die zweite Besonderheit<br />
liegt in der Vorbildung der Zielgruppe. So weisen in den Klassen mindestens 2/3 der Schülerinnen<br />
<strong>und</strong> Schüler die Fachoberschulreife oder Abitur auf. Sie gelten als angenehme Klassen,<br />
in denen gerne unterrichtet wird. Drittens sind aufgr<strong>und</strong> der geringen Zahl von Ausbildungsverträgen<br />
verschiedene Berufe (Damen- <strong>und</strong> Herrenschneider, Sticker, Sonstige) in<br />
den Klassen vereint. Für die Ausbildungsberufe liegen ältere Ausbildungsordnungen, Rahmenlehrpläne<br />
<strong>und</strong> Richtlinien/Lehrpläne vor, die aber bereits schulintern auf moderne Erfordernisse<br />
(Nähmaschinentechnik, EDV-Einsatz, Gestaltung) angepasst worden sind, was die<br />
betriebliche Seite ausdrücklich begrüßt. Es ist deutlich ein gemeinsames Interesse bei<br />
Betrieben <strong>und</strong> Schule zu erkennen, den Ausbildungsberuf in den Innungsbereichen Bonn/<br />
Köln/Leverkusen auf Klassenstärke zu erhalten, um ggf. ortsferne <strong>und</strong> in Blöcken organisierte<br />
Beschulung zu vermeiden.<br />
Die genannten Besonderheiten lassen in der ergebnisorientierten Darstellung drei Schwerpunkte<br />
notwendig werden:<br />
• Der dreiwöchige Rhythmus des zweiten Berufschultages ist schulintern schwer zu organisieren;<br />
bei dreijährigen Bildungsgängen mit nur einer Klasse pro Ausbildungsjahr kann er<br />
zwar so organisiert werden, dass ein Wochentag durchgängig als zweiter Tag von Lehrerinnen<br />
<strong>und</strong> Lehrern besetzt werden kann. Sobald aber weniger oder mehr (nicht durch<br />
drei teilbare) Klassenstärken gegeben sind, wird eine Lehrkraft für die St<strong>und</strong>en faktisch<br />
besetzt, ohne dass sich für die Lehrkraft ein regelmäßiger Wochenst<strong>und</strong>enplan mit adäquater<br />
St<strong>und</strong>endeputatsanrechnung ergibt. Dies führt st<strong>und</strong>enplantechnisch individuell<br />
wie institutionell zu suboptimalen Lösungen in Form von Freist<strong>und</strong>en oder geringeren<br />
Einsatzmöglichkeiten in anderen Bildungsgängen, die im zweiwöchigen Rhythmus gestaltet<br />
sind. Sofern der St<strong>und</strong>enplan noch Fächer vorsieht, ist eine Verteilung der St<strong>und</strong>enzahl<br />
im vorgesehenen Maße kaum möglich. In den Modellversuchsklassen war es so<br />
notwendig, auch am durchgängigen <strong>Berufsschultag</strong> einen vierzehntägigen Fachwechsel<br />
zwischen „Gestaltung“ <strong>und</strong> „Technologischen Übungen“ einzuführen. Es wurde beklagt,<br />
dass der Kontakt zu den Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern in den Fächern, die nur alle drei Wochen<br />
unterrichtet wurden, erheblich schwerer aufgebaut werden konnte. 27<br />
• Zu den Auswirkungen der zusätzlichen neunten St<strong>und</strong>e äußerten sich die Schülerinnen<br />
<strong>und</strong> Schüler in mehreren Gruppendiskussionen dahingehend, dass der <strong>Berufsschultag</strong><br />
auch der Tag sei, an dem noch sonstige Erledigungen zu machen seien (Behördengänge,<br />
Arztbesuche etc.). Aufgr<strong>und</strong> der betrieblichen <strong>Arbeit</strong>szeiten <strong>und</strong> der kleinen Betriebsgrößen<br />
sei dies an einem normalen <strong>Arbeit</strong>stag mit größeren Schwierigkeiten verb<strong>und</strong>en. Die<br />
neunte St<strong>und</strong>e sei so „genau über der Schmerzgrenze“, insbesondere wenn noch längere<br />
Fahrzeiten berücksichtigt werden müssen. „Deshalb sei es manchmal klüger, gar nicht<br />
oder später zu erscheinen“. Es artikulieren sich hier intelligente Vermeidungsstrategien,<br />
die nicht hauptsächlich über Belastung oder Konzentrationsmängel zu begründen sind,<br />
sondern über die Akzeptanz des Berufsschulunterrichts bzw. den Opportunitätskosten<br />
einer neunten St<strong>und</strong>e. In der Fehlzeitenanalyse stellt sich dies über Anwesenheitsquoten<br />
von 86%, 95% <strong>und</strong> 91% sowie einer Verspätungsquote von durchschnittlich 4,45 Verspä-<br />
27 In einer Diskussion auf einer Bildungsgangkonferenz kam hier die spiegelbildliche Position zwischen<br />
Ausbildern <strong>und</strong> Lehrern zum Ausdruck. Während die Ausbilderin bemerkte, dass sich die Beobac h-<br />
tungs- <strong>und</strong> Kennenlernphase in der Probezeit für den Betrieb positiv verändert habe, teilte die Lehrerin<br />
mit dreiwöchigem Rhythmus genau die umgekehrte Beobachtung mit.<br />
73