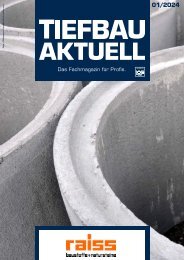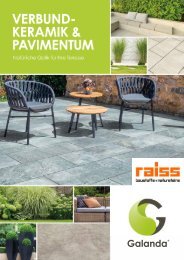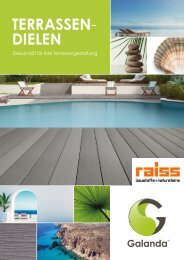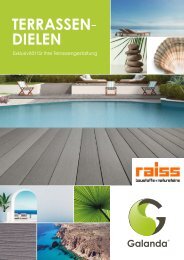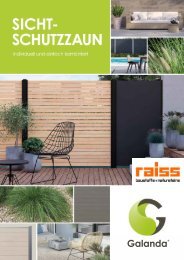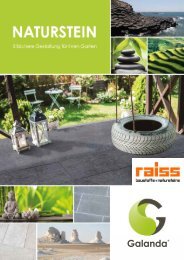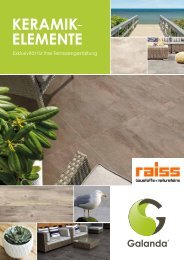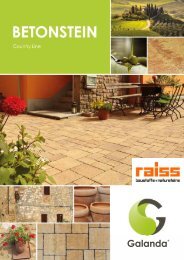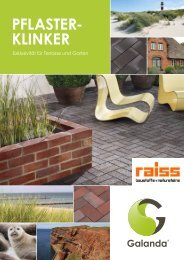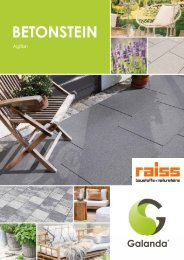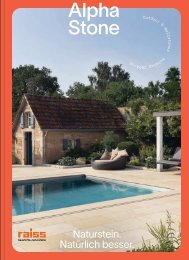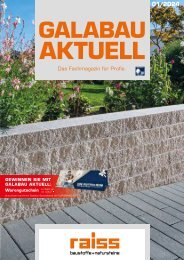1x1 der Holzprodukte - Raiss
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
GLOSSAR<br />
Dauerhaftigkeitsklassen<br />
nach DIN EN 350 meint die Klassifikation <strong>der</strong> natürlichen Dauerhaftigkeit<br />
gegen Holz zerstörende Pilze.<br />
Dauerhaftigkeitsklasse<br />
Beschreibung Beispiele<br />
1 sehr dauerhaft Teak, Ipé, Afzelia<br />
2 dauerhaft Azobe (Bongossi)<br />
3<br />
Eiche<br />
mäßig dauerhaft<br />
3-4 Lärche, Douglasie<br />
4 wenig dauerhaft Tanne, Fichte, Kiefer<br />
5 nicht dauerhaft Buche, Ahorn<br />
Tab. Glossar. 1 Zuordnung <strong>der</strong> gebräuchlichen Holzarten zu den<br />
Dauerhaftigkeitsklassen nach DIN EN 350.<br />
Dampfbremse<br />
reduzieren den Feuchteeintrag in die Konstruktion und werden auf <strong>der</strong><br />
Raumseite eingebaut. Sie können aus Bahnen, Platten o<strong>der</strong> Putzen<br />
hergestellt werden. Im Holzbau haben sich Dampfbremsen mit einem<br />
s d -Wert von 2,0 m bis 5,0 m bewährt. Dies gilt für Bauteile, die<br />
außen diffusionsoffen mit einem s d -Wert bis 0,3 m abgedeckt sind<br />
(Unterdeckung). Zwischen Dampfbremse und Unterdeckung ist <strong>der</strong><br />
Konstruktionsraum vollständig mit Dämmstoff ausgefüllt (keine Luftschicht!).<br />
Als Faustregel gilt: die innere dampfbremsende Schicht sollte ca. 10 mal<br />
diffusionsdichter (s d -Wert höher) sein als die äußere Schicht des Bauteils.<br />
Als Unterdeckung auf <strong>der</strong> Außenseite haben sich die Holzfaserdämmplatten<br />
bestens bewährt. Hinterlüftete Fassaden bleiben in dieser<br />
Betrachtung unberücksichtigt.<br />
Detailliert wird das Thema Feuchteschutz in Profi-Wissen Holzbau im<br />
Abschn. C4 behandelt.<br />
Dampfsperre<br />
wird als Begriff in den einschlägigen Normen nicht definiert. Bei den üblichen<br />
Konstruktionen des Holzbaus ist immer wie<strong>der</strong> fälschlicher Weise<br />
von Dampfsperren die Rede. Gemeint sind allerdings Dampfbremsen<br />
mit einem begrenzten s d -Wert. Der Autor verwendet den Begriff „Dampfsperren“<br />
für Bauteilschichten mit einem s d -Wert ab 5,0 Metern.<br />
Dickenquellung<br />
Aufgrund des hygroskopischen Verhaltens von Holz kommt es zu<br />
Dickenquellungen bei Feuchteaufnahme. Dies ist insbeson<strong>der</strong>e bei<br />
Holzwerkstoffen zu begrenzen (Prüfung nach DIN EN 317, bei 24 Stunden<br />
Wasserlagerung). Siehe auch Schwinden und Quellen.<br />
Diffusionsfähigkeit<br />
siehe „s d -Wert“<br />
Dimensionsstabilität<br />
die Dimensions- und Formstabilität eines Holzes (häufig auch als Maßhaltigkeit<br />
o<strong>der</strong> Stehvermögen bezeichnet), ist eine sehr komplexe<br />
Größe, die von vielen Einflussfaktoren abhängt:<br />
- absolutes Schwind- bzw. Quellmaß,<br />
- Anisotropie von Quellung und Schwindung<br />
(Unterschied zwischen tangentialer und radialer Bewegung),<br />
- Abweichung des Faserverlaufs,<br />
- Angleichgeschwindigkeit <strong>der</strong> Holzfeuchte,<br />
- Querschnittsabmessungen,<br />
- Querschnittsverklebung,<br />
- Inhomogenität des Umgebungsklimas.<br />
Allgemein kann man davon ausgehen, dass die Dimensions- und<br />
Formstabilität schlechter wird, je mehr und je anisotroper eine Holzart<br />
schwindet o<strong>der</strong> quillt und je rascher sie mit ihrer Holzfeuchte auf Klimawechsel<br />
reagiert.<br />
Zahlenmäßig ist dieses Merkmal bislang schlecht unterlegt, so dass<br />
beschreibend unterschieden wird zwischen Arten:<br />
- sehr guter Formstabilität (z. B. Teak),<br />
- guter Formstabilität (z. B. Iroko),<br />
- mittlerer Formstabilität (z. B. Lärche),<br />
- geringer Formstabilität (z. B. Buche).<br />
DIN 1052<br />
ist eine frühere Norm zur Bemessung und Ausführung von tragenden<br />
Konstruktionen des Holzbaus. Die Norm wurde ersetzt durch die Euronorm<br />
DIN EN 1995-1-1 (Eurocode EC 5).<br />
Dispersion<br />
wird als Beschichtung o<strong>der</strong> Klebstoff angewendet. Es handelt sich dabei<br />
um Kleinstteile, die in Wasser aufgelöst sind. D. ist <strong>der</strong> Oberbegriff für:<br />
• Suspension, Zerteilung eines festen Stoffes und<br />
• Emulsion, Zerteilung eines flüssigen Stoffes in einer Flüssigkeit.<br />
Nach dem Auftragen wird die Feuchtigkeit vom Untergrund kapillar aufgenommen<br />
o<strong>der</strong> trocknet in die Umgebung ab. Die Teilchen verbinden<br />
sich bei dem Austrocknungsprozess zu einem Film. Bei den Klebstoffen<br />
ist beson<strong>der</strong>s das Polyvinylacetat (PVAc) als „Weißleim“ bekannt und<br />
gehört zu den synthetischen Thermoplasten.<br />
Duroplaste<br />
gehören zu den Klebstoffen. Im Gegensatz zu den Thermoplasten<br />
binden Duroplaste zu einem festen, unlösbaren und unschmelzbaren<br />
Endzustand. Sie bauen sich aus Raumnetzmolekülen auf.<br />
Für die Verklebung von Holz spielen Duroplaste die bedeutende Rolle.<br />
Es gibt drei Gruppen:<br />
• Aminoplaste mit <strong>der</strong> Basis<br />
- Harnstoff und Formaldehyd<br />
- Melamin und Formaldehyd<br />
• Phenolplaste mit <strong>der</strong> Basis<br />
- Phenol und Formaldehyd<br />
- Resorcin und Formaldehyd<br />
• Isocyanate (PMDI)<br />
Harnstoffharze sind wasserlöslich, alle an<strong>der</strong>en genannten<br />
Klebstoffe sind feuchtebeständige Verklebungen.<br />
298