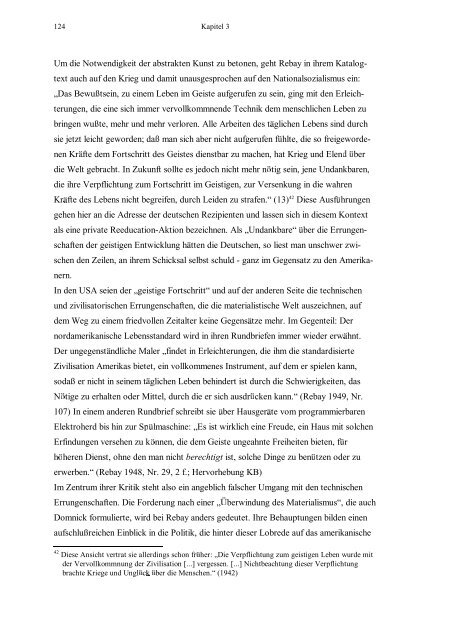Download (8Mb)
Download (8Mb)
Download (8Mb)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
124<br />
Kapitel 3<br />
Um die Notwendigkeit der abstrakten Kunst zu betonen, geht Rebay in ihrem Katalogtext<br />
auch auf den Krieg und damit unausgesprochen auf den Nationalsozialismus ein:<br />
„Das Bewußtsein, zu einem Leben im Geiste aufgerufen zu sein, ging mit den Erleichterungen,<br />
die eine sich immer vervollkommnende Technik dem menschlichen Leben zu<br />
bringen wußte, mehr und mehr verloren. Alle Arbeiten des t glichen Lebens sind durch<br />
sie jetzt leicht geworden; daß man sich aber nicht aufgerufen f hlte, die so freigewordenen<br />
Kr fte dem Fortschritt des Geistes dienstbar zu machen, hat Krieg und Elen<br />
die Welt gebracht. In Zukunft sollte es jedoch nicht mehr n tig sein, jene Undankbaren,<br />
die ihre Verpflichtung zum Fortschritt im Geistigen, zur Versenkung in die wahren<br />
Kr fte des Lebens nicht begreifen, durch Leiden zu strafen.“ (13) 42 Diese Ausf hrungen<br />
gehen hier an die Adresse der deutschen Rezipienten und lassen sich in diesem Kontext<br />
als eine private Reeducation-Aktion bezeichnen. Als „Undankbare“ ber die Errungenschaften<br />
der geistigen Entwicklung h tten die Deutschen, so liest man unschwer zwischen<br />
den Zeilen, an ihrem Schicksal selbst schuld - ganz im Gegensatz zu den Amerikanern.<br />
In den USA seien der „geistige Fortschritt“ und auf der anderen Seite die technischen<br />
und zivilisatorischen Errungenschaften, die die materialistische Welt auszeichnen, auf<br />
dem Weg zu einem friedvollen Zeitalter keine Gegens tze mehr. Im Gegenteil: Der<br />
nordamerikanische Lebensstandard wird in ihren Rundbriefen immer wieder erw hnt.<br />
Der ungegenst ndliche Maler „findet in Erleichterungen, die ihm die standardisierte<br />
Zivilisation Amerikas bietet, ein vollkommenes Instrument, auf dem er spielen kann,<br />
sodaß er nicht in seinem t glichen Leben behindert ist durch die Schwierigkeiten, das<br />
N tige zu erhalten oder Mittel, durch die er sich ausdr cken kann.“ (Rebay 1949, Nr.<br />
107) In einem anderen Rundbrief schreibt sie ber Hausger te vom programmierbaren<br />
Elektroherd bis hin zur S<br />
ber<br />
lmaschine: „Es ist wirklich eine Freude, ein Haus mit solchen<br />
Erfindungen versehen zu k nnen, die dem Geiste ungeahnte Freiheiten bieten, f r<br />
h heren Dienst, ohne den man nicht berechtigt ist, solche Dinge zu ben tzen oder zu<br />
erwerben.“ (Rebay 1948, Nr. 29, 2 f.; Hervorhebung KB)<br />
Im Zentrum ihrer Kritik steht also ein angeblich falscher Umgang mit den technischen<br />
Errungenschaften. Die Forderung nach einer „ berwindung des Materialismus“, die auch<br />
Domnick formulierte, wird bei Rebay anders gedeutet. Ihre Behauptungen bilden einen<br />
aufschlußreichen Einblick in die Politik, die hinter dieser Lobrede auf das amerikanische<br />
42 Diese Ansicht vertrat sie allerdings schon fr her: „Die Verpflichtung zum geistigen Leben wurde mit<br />
der Vervollkommnung der Zivilisation [...] vergessen. [...] Nichtbeachtung dieser Verpflichtung<br />
brachte Kriege und Ungl c ber die Menschen.“ (1942)