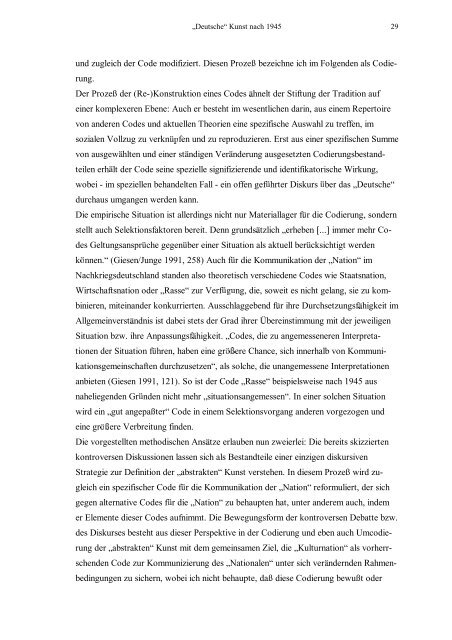Download (8Mb)
Download (8Mb)
Download (8Mb)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
„Deutsche“ Kunst nach 1945 29<br />
und zugleich der Code modifiziert. Diesen Prozeß bezeichne ich im Folgenden als Codierung.<br />
Der Prozeß der (Re-)Konstruktion eines Codes hnelt der Stiftung der Tradition auf<br />
einer komplexeren Ebene: Auch er besteht im wesentlichen darin, aus einem Repertoire<br />
von anderen Codes und aktuellen Theorien eine spezifische Auswahl zu treffen, im<br />
sozialen Vollzug zu verkn fen und zu reproduzieren. Erst aus einer spezifischen Summe<br />
von ausgew hlten und einer st ndigen Ver nderung ausgesetzten Codierungsbestandteilen<br />
erh lt der Code seine spezielle signifizierende und identifikatorische Wirkung,<br />
wobei - im speziellen behandelten Fall - ein offen gef hrter Diskurs ber das „Deutsche“<br />
durchaus umgangen werden kann.<br />
Die empirische Situation ist allerdings nicht nur Materiallager f r die Codierung, sondern<br />
stellt auch Selektionsfaktoren bereit. Denn grunds tzlich „erheben [...] immer mehr Codes<br />
Geltungsanspr che gegen ber einer Situation als aktuell ber cksichtigt werden<br />
k nnen.“ (Giesen/Junge 1991, 258) Auch f r die Kommunikation der „Nation“ im<br />
Nachkriegsdeutschland standen also theoretisch verschiedene Codes wie Staatsnation,<br />
Wirtschaftsnation oder „Rasse“ zur Verf ng, die, soweit es nicht gelang, sie zu kombinieren,<br />
miteinander konkurrierten. Ausschlaggebend f r ihre Durchsetzungsf higkeit im<br />
Allgemeinverst ndnis ist dabei stets der Grad ihrer bereinstimmung mit der jeweiligen<br />
Situation bzw. ihre Anpassungsf higkeit. „Codes, die zu angemesseneren Interpretationen<br />
der Situation f hren, haben eine gr ere Chance, sich innerhalb von Kommunikationsgemeinschaften<br />
durchzusetzen“, als solche, die unangemessene Interpretationen<br />
anbieten (Giesen 1991, 121). So ist der Code „Rasse“ beispielsweise nach 1945 aus<br />
naheliegenden Gr nden nicht mehr „situationsangemessen“. In einer solchen Situation<br />
wird ein „gut angepaßter“ Code in einem Selektionsvorgang anderen vorgezogen und<br />
eine gr ere Verbreitung finden.<br />
Die vorgestellten methodischen Ans tze erlauben nun zweierlei: Die bereits skizzierten<br />
kontroversen Diskussionen lassen sich als Bestandteile einer einzigen diskursiven<br />
Strategie zur Definition der „abstrakten“ Kunst verstehen. In diesem Prozeß wird zugleich<br />
ein spezifischer Code f r die Kommunikation der „Nation“ reformuliert, der sich<br />
gegen alternative Codes f r die „Nation“ zu behaupten hat, unter anderem auch, indem<br />
er Elemente dieser Codes aufnimmt. Die Bewegungsform der kontroversen Debatte bzw.<br />
des Diskurses besteht aus dieser Perspektive in der Codierung und eben auch Umcodierung<br />
der „abstrakten“ Kunst mit dem gemeinsamen Ziel, die „Kulturnation“ als vorherrschenden<br />
Code zur Kommunizierung des „Nationalen“ unter sich ver ndernden Rahmenbedingungen<br />
zu sichern, wobei ich nicht behaupte, daß diese Codierung bewußt oder