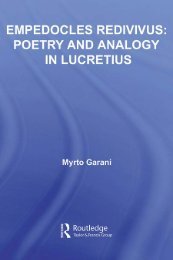- Page 2:
Body and Soul in Ancient Philosophy
- Page 5 and 6:
Printed on acid-free paper which fa
- Page 7 and 8:
VI Preface the program and were wel
- Page 9 and 10:
VIII Contents Jan Szaif Die aretÞ
- Page 12 and 13:
Introduction 1 The topic The body-s
- Page 14 and 15:
Introduction 3 of the Classical and
- Page 16 and 17:
Introduction 5 those put forward by
- Page 18 and 19:
Introduction 7 principles of atomis
- Page 20 and 21:
Introduction 9 vidual’s own conce
- Page 22 and 23:
Introduction 11 terpart of the stri
- Page 24 and 25:
Introduction 13 body does not count
- Page 26 and 27:
Introduction 15 When Tertullian rej
- Page 28:
Introduction 17 and, for that matte
- Page 32 and 33:
The Pythagorean conception of the s
- Page 34 and 35:
The Pythagorean conception of the s
- Page 36 and 37:
The Pythagorean conception of the s
- Page 38 and 39:
The Pythagorean conception of the s
- Page 40 and 41:
The Pythagorean conception of the s
- Page 42 and 43:
The Pythagorean conception of the s
- Page 44 and 45:
The Pythagorean conception of the s
- Page 46 and 47:
The Pythagorean conception of the s
- Page 48 and 49:
The Pythagorean conception of the s
- Page 50 and 51:
The Pythagorean conception of the s
- Page 52 and 53:
The Pythagorean conception of the s
- Page 54:
The Pythagorean conception of the s
- Page 57 and 58:
46 Christian Schäfer 1. Vorüberle
- Page 59 and 60:
48 Christian Schäfer zung betracht
- Page 61 and 62:
50 Christian Schäfer gemacht wird.
- Page 63 and 64:
52 Christian Schäfer Das Pythagora
- Page 65 and 66:
54 Christian Schäfer 3. Die Kritik
- Page 67 and 68:
56 Christian Schäfer seiner Adepte
- Page 69 and 70:
58 Christian Schäfer Eine letzte E
- Page 71 and 72:
60 Christian Schäfer Transmigratio
- Page 73 and 74:
62 Christian Schäfer (wohl aber um
- Page 75 and 76:
64 Christian Schäfer auf eine solc
- Page 77 and 78:
66 Christian Schäfer Gruppe allein
- Page 79 and 80:
68 Christian Schäfer Umkehrung des
- Page 82 and 83:
Empedocles and metempsychôsis: The
- Page 84 and 85:
Empedocles and metempsychôsis: The
- Page 86 and 87:
Empedocles and metempsychôsis: The
- Page 88 and 89:
Empedocles and metempsychôsis: The
- Page 90 and 91:
Empedocles and metempsychôsis: The
- Page 92 and 93:
Empedocles and metempsychôsis: The
- Page 94 and 95:
Empedocles and metempsychôsis: The
- Page 96 and 97:
Empedocles and metempsychôsis: The
- Page 98 and 99:
Heraclitus on measure and the expli
- Page 100 and 101:
Heraclitus on measure and the expli
- Page 102 and 103:
Heraclitus on measure and the expli
- Page 104 and 105:
Heraclitus on measure and the expli
- Page 106 and 107:
Heraclitus on measure and the expli
- Page 108 and 109:
Heraclitus on measure and the expli
- Page 110 and 111:
Heraclitus on measure and the expli
- Page 112 and 113:
Heraclitus on measure and the expli
- Page 114 and 115:
Heraclitus on measure and the expli
- Page 116 and 117:
Heraclitus on measure and the expli
- Page 118 and 119:
Heraclitus on measure and the expli
- Page 120:
Heraclitus on measure and the expli
- Page 123 and 124:
112 Georg Rechenauer gefallen, sich
- Page 125 and 126:
114 Georg Rechenauer jenes späterh
- Page 127 and 128:
116 Georg Rechenauer durch einen T
- Page 129 and 130:
118 Georg Rechenauer Natur klassifi
- Page 131 and 132:
120 Georg Rechenauer sitzen“ 26 .
- Page 133 and 134:
122 Georg Rechenauer sind. 33 Insof
- Page 135 and 136:
124 Georg Rechenauer mokrit die log
- Page 137 and 138:
126 Georg Rechenauer und bewegen ih
- Page 139 and 140:
128 Georg Rechenauer Bewegungstende
- Page 141 and 142:
130 Georg Rechenauer Antwort auf da
- Page 143 and 144:
132 Georg Rechenauer nicht anders z
- Page 145 and 146:
134 Georg Rechenauer Demokrit eine
- Page 147 and 148:
136 Georg Rechenauer die Wahl diese
- Page 149 and 150:
138 Georg Rechenauer ist, 87 oder,
- Page 151 and 152:
140 Georg Rechenauer Seelenatome ei
- Page 153 and 154:
142 Georg Rechenauer kann. Im äuß
- Page 156 and 157:
Three kinds of Platonic immortality
- Page 158 and 159:
able doubt, the argument is intende
- Page 160 and 161:
Three kinds of Platonic immortality
- Page 162 and 163:
Three kinds of Platonic immortality
- Page 164 and 165:
Three kinds of Platonic immortality
- Page 166 and 167:
Three kinds of Platonic immortality
- Page 168 and 169:
Three kinds of Platonic immortality
- Page 170 and 171:
Three kinds of Platonic immortality
- Page 172:
Three kinds of Platonic immortality
- Page 175 and 176:
164 Michael Erler gegenüber gewöh
- Page 177 and 178:
166 Michael Erler Protophilosoph tr
- Page 179 and 180:
168 Michael Erler Platon sie als Ge
- Page 181 and 182:
170 Michael Erler krates’ bevorst
- Page 183 and 184:
172 Michael Erler immer sich selbst
- Page 185 and 186:
174 Michael Erler womit im idealen
- Page 187 and 188:
176 Michael Erler Sokrates’ Kebes
- Page 189 and 190:
178 Michael Erler handlung gehört
- Page 191 and 192:
180 Gyburg Radke-Uhlmann Hatte scho
- Page 193 and 194:
182 Gyburg Radke-Uhlmann Definition
- Page 195 and 196:
184 Gyburg Radke-Uhlmann zweitens d
- Page 197 and 198:
186 Gyburg Radke-Uhlmann nach einer
- Page 199 and 200:
188 Gyburg Radke-Uhlmann seine begr
- Page 201 and 202:
190 Gyburg Radke-Uhlmann Wesen und
- Page 203 and 204:
192 Gyburg Radke-Uhlmann Erkenntnis
- Page 205 and 206:
194 Gyburg Radke-Uhlmann reden hör
- Page 207 and 208:
196 Gyburg Radke-Uhlmann phischen T
- Page 209 and 210:
198 Gyburg Radke-Uhlmann Schluss nu
- Page 211 and 212:
200 Gyburg Radke-Uhlmann der hinrei
- Page 213 and 214:
202 Gyburg Radke-Uhlmann Noch immer
- Page 216 and 217:
Die aretÞ 1 des Leibes: Die Stellu
- Page 218 and 219:
Die aretÞ des Leibes 207 es sehr d
- Page 220 and 221:
Die aretÞ des Leibes 209 Tugend od
- Page 222 and 223: a) notwendig und hinreichend, b) hi
- Page 224 and 225: Die aretÞ des Leibes 213 Die mögl
- Page 226 and 227: Die aretÞ des Leibes 215 Platon l
- Page 228 and 229: Die aretÞ des Leibes 217 ambivalen
- Page 230 and 231: Die aretÞ des Leibes 219 Weise sei
- Page 232 and 233: Die aretÞ des Leibes 221 folgt dar
- Page 234 and 235: Einteilung G a) Güter, die keine w
- Page 236 and 237: Die aretÞ des Leibes 225 Gemäß d
- Page 238 and 239: Die aretÞ des Leibes 227 Feststell
- Page 240 and 241: Die aretÞ des Leibes 229 der ganze
- Page 242 and 243: Die aretÞ des Leibes 231 verständ
- Page 244 and 245: seelische Verfassung ist gut und eu
- Page 246 and 247: Die aretÞ des Leibes 235 weitere n
- Page 248 and 249: Die aretÞ des Leibes 237 ordnet. E
- Page 250 and 251: Die aretÞ des Leibes 239 beiträgt
- Page 252 and 253: Die aretÞ des Leibes 241 das Ziel
- Page 254 and 255: Die aretÞ des Leibes 243 Dies folg
- Page 256 and 257: Die aretÞ des Leibes 245 findet si
- Page 258: III. Aristotle
- Page 261 and 262: 250 Günther Patzig Hunden und Vög
- Page 263 and 264: 252 Günther Patzig Gleichheit durc
- Page 265 and 266: 254 Günther Patzig Tiere haben neb
- Page 267 and 268: 256 Günther Patzig werden. Eine so
- Page 269 and 270: 258 Günther Patzig men, so wäre e
- Page 271: 260 Günther Patzig Über den Mecha
- Page 275 and 276: 264 Günther Patzig logischen Proze
- Page 277 and 278: 266 Günther Patzig solcher schwier
- Page 279 and 280: 268 Christopher Shields Here the im
- Page 281 and 282: 270 Christopher Shields istotle’s
- Page 283 and 284: 272 Christopher Shields II. Reconst
- Page 285 and 286: 274 Christopher Shields cause of be
- Page 287 and 288: 276 Christopher Shields P 5 : In th
- Page 289 and 290: 278 Christopher Shields namely Meta
- Page 291 and 292: 280 Christopher Shields of the body
- Page 293 and 294: 282 Christopher Shields to regardin
- Page 295 and 296: 284 Christopher Shields ¦speq eU t
- Page 297 and 298: 286 Christopher Shields it is a mer
- Page 299 and 300: 288 Christopher Shields To be clear
- Page 301 and 302: 290 Christopher Shields soul - as a
- Page 303 and 304: 292 David Charles I.1. This discuss
- Page 305 and 306: 294 David Charles Mathematical obje
- Page 307 and 308: 296 David Charles blood which is di
- Page 309 and 310: 298 David Charles 3. Desire: A mode
- Page 311 and 312: 300 David Charles There are, it see
- Page 313 and 314: 302 David Charles ing/expanding/pus
- Page 315 and 316: 304 David Charles moves the body by
- Page 317 and 318: 306 David Charles relevant aspects
- Page 320 and 321: Aristoteles’ Zirbeldrüse? Zum Ve
- Page 322 and 323:
Aristoteles’ Zirbeldrüse? 311
- Page 324 and 325:
Aristoteles’ Zirbeldrüse? 313 Te
- Page 326 and 327:
Aristoteles’ Zirbeldrüse? 315 de
- Page 328 and 329:
Aristoteles’ Zirbeldrüse? 317 si
- Page 330 and 331:
Aristoteles’ Zirbeldrüse? 319 se
- Page 332 and 333:
Aristoteles’ Zirbeldrüse? 321 -
- Page 334 and 335:
Aristoteles’ Zirbeldrüse? 323 Ar
- Page 336 and 337:
Aristoteles’ Zirbeldrüse? 325 ei
- Page 338 and 339:
Aristoteles’ Zirbeldrüse? 327 si
- Page 340:
Aristoteles’ Zirbeldrüse? 329 St
- Page 343 and 344:
332 Ursula Wolf charakterlich gut z
- Page 345 and 346:
334 Ursula Wolf sinnlichen Antriebe
- Page 347 and 348:
336 Ursula Wolf anima sagt, der enk
- Page 349 and 350:
338 Ursula Wolf sondern die Bewahru
- Page 351 and 352:
340 Ursula Wolf (ii) Besitzt der en
- Page 353 and 354:
342 Ursula Wolf Wunsch, das kalon z
- Page 355 and 356:
344 Ursula Wolf Aber warum bereut d
- Page 357 and 358:
346 Ursula Wolf Bezug auf die beide
- Page 360 and 361:
How does the soul direct the body,
- Page 362 and 363:
How does the soul direct the body,
- Page 364 and 365:
How does the soul direct the body,
- Page 366 and 367:
How does the soul direct the body,
- Page 368:
V. Hellenism
- Page 371 and 372:
360 Keimpe Algra curs, as the Tract
- Page 373 and 374:
362 Keimpe Algra ing human souls. T
- Page 375 and 376:
364 Keimpe Algra diary and mediator
- Page 377 and 378:
366 Keimpe Algra school. Yet as soo
- Page 379 and 380:
368 Keimpe Algra the same time that
- Page 381 and 382:
370 Keimpe Algra selves, and are no
- Page 383 and 384:
372 Keimpe Algra is the soul of the
- Page 385 and 386:
374 Keimpe Algra we find the claim
- Page 387 and 388:
376 Keimpe Algra Xenocrates and oth
- Page 389 and 390:
378 Keimpe Algra 6. Evil demons and
- Page 391 and 392:
380 Keimpe Algra The translation an
- Page 393 and 394:
382 Keimpe Algra with them, whereas
- Page 395 and 396:
384 Keimpe Algra Lares are spirits
- Page 397 and 398:
386 Keimpe Algra However, we have r
- Page 400 and 401:
Stoic souls in Stoic corpses 1 Tad
- Page 402 and 403:
Stoic souls in Stoic corpses 391 wa
- Page 404 and 405:
Stoic souls in Stoic corpses 393 An
- Page 406 and 407:
Stoic souls in Stoic corpses 395 li
- Page 408 and 409:
Antiochus’ next objection then pi
- Page 410 and 411:
Stoic souls in Stoic corpses 399 th
- Page 412 and 413:
Stoic souls in Stoic corpses 401 cl
- Page 414 and 415:
Stoic souls in Stoic corpses 403 th
- Page 416 and 417:
In the later Platonist tradition, a
- Page 418:
Stoic souls in Stoic corpses 407 qu
- Page 421 and 422:
410 Christopher Gill What I want to
- Page 423 and 424:
412 Christopher Gill than Galen him
- Page 425 and 426:
414 Christopher Gill they did not i
- Page 427 and 428:
416 Christopher Gill may reflect th
- Page 429 and 430:
418 Christopher Gill thesised for t
- Page 431 and 432:
420 Christopher Gill case of the he
- Page 433 and 434:
422 Christopher Gill tional command
- Page 436 and 437:
Philosophical norms and political a
- Page 438 and 439:
Philosophical norms and political a
- Page 440 and 441:
Philosophical norms and political a
- Page 442 and 443:
Philosophical norms and political a
- Page 444 and 445:
Philosophical norms and political a
- Page 446 and 447:
Philosophical norms and political a
- Page 448 and 449:
Philosophical norms and political a
- Page 450 and 451:
Philosophical norms and political a
- Page 452 and 453:
Philosophical norms and political a
- Page 454 and 455:
Philosophical norms and political a
- Page 456:
VI. Philosophers of Early Christian
- Page 459 and 460:
448 Jonathan Barnes On the other ha
- Page 461 and 462:
450 Jonathan Barnes ity of choice a
- Page 463 and 464:
452 Jonathan Barnes philosophers”
- Page 465 and 466:
454 Jonathan Barnes He was neither
- Page 467 and 468:
456 Jonathan Barnes good argument f
- Page 469 and 470:
458 Jonathan Barnes The soul, Tertu
- Page 471 and 472:
460 Jonathan Barnes St. Paul distin
- Page 473 and 474:
462 Jonathan Barnes an’s psycholo
- Page 475 and 476:
464 Jonathan Barnes power or capaci
- Page 477 and 478:
466 Therese Fuhrer beiden civitates
- Page 479 and 480:
468 Therese Fuhrer antiken Naturphi
- Page 481 and 482:
470 Therese Fuhrer 3. Die Konstrukt
- Page 483 and 484:
472 Therese Fuhrer werden kann, nac
- Page 485 and 486:
474 Therese Fuhrer nen, da es doch
- Page 487 and 488:
476 Therese Fuhrer - oder sogar noc
- Page 489 and 490:
478 Therese Fuhrer … warum wollen
- Page 491 and 492:
480 Therese Fuhrer skizziert er ein
- Page 493 and 494:
482 Therese Fuhrer der Natur der G
- Page 495 and 496:
484 Therese Fuhrer platonischen Sch
- Page 497 and 498:
486 Therese Fuhrer - Identität des
- Page 499 and 500:
488 Therese Fuhrer Wenn also klar i
- Page 501 and 502:
490 Therese Fuhrer Auferstehungsleh
- Page 504 and 505:
Die Auferstehung des Leibes Theo Ko
- Page 506 and 507:
Die Auferstehung des Leibes 495 Dia
- Page 508 and 509:
Die Auferstehung des Leibes 497 Es
- Page 510 and 511:
Die Auferstehung des Leibes 499 tr
- Page 512 and 513:
Die Auferstehung des Leibes 501 Auc
- Page 514 and 515:
Die Auferstehung des Leibes 503 Hä
- Page 516 and 517:
Die Auferstehung des Leibes 505 ist
- Page 518 and 519:
Die Auferstehung des Leibes 507 zei
- Page 520 and 521:
Die Auferstehung des Leibes 509 wer
- Page 522 and 523:
Bibliography Ackrill, J. L. (1972/1
- Page 524 and 525:
Bibliography 513 Brieger, A. (1902)
- Page 526 and 527:
Bibliography 515 - (2002) “Epicur
- Page 528 and 529:
Bibliography 517 Halliwell, S. (198
- Page 530 and 531:
Bibliography 519 Kim, J. (1996) Phi
- Page 532 and 533:
Bibliography 521 May, M. T. (1968)
- Page 534 and 535:
Bibliography 523 Reis, B. (2006) (e
- Page 536 and 537:
Bibliography 525 - (2004) Platon un
- Page 538 and 539:
Index nominum Achill/Achilles 103,
- Page 540 and 541:
Index nominum 529 Pindar 102, 104 P
- Page 542 and 543:
Index locorum Aelianus Varia Histor
- Page 544 and 545:
Index locorum 533 432b18 282, n. 22
- Page 546 and 547:
Index locorum 535 701b34 - 702a10 3
- Page 548 and 549:
Index locorum 537 22.16 479 22.18 4
- Page 550 and 551:
Index locorum 539 DK 68 B 34 133, n
- Page 552 and 553:
Index locorum 541 89 38, n. 50; 39,
- Page 554 and 555:
Index locorum 543 Marcus Aurelius A
- Page 556 and 557:
Index locorum 545 59a 171, n. 31 59
- Page 558 and 559:
Index locorum 547 604d 172, n. 34;
- Page 560 and 561:
Index locorum 549 In Aristotelis Me
- Page 562:
Index locorum 551 Is 66.22 470, n.
- Page 565 and 566:
554 Index rerum Behinderung 194 bei
- Page 567 and 568:
556 Index rerum 221, 225, 230, 233,
- Page 569 and 570:
558 Index rerum motion (! Bewegung)
- Page 571 and 572:
560 Index rerum self-criticism 431
- Page 573:
562 Index rerum Zeus 50, 98, 99, 10





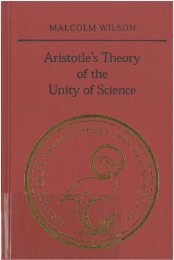
![[Niall_Livingstone]_A_Commentary_on_Isocrates'_Busiris](https://img.yumpu.com/51449110/1/163x260/niall-livingstone-a-commentary-on-isocrates-busiris.jpg?quality=85)
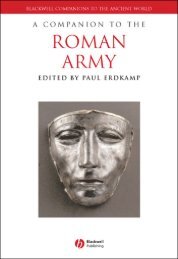
![[Richard_Sorabji]_Self__Ancient_and_Modern_Insigh(BookFi.org)](https://img.yumpu.com/30857691/1/174x260/richard-sorabji-self-ancient-and-modern-insighbookfiorg.jpg?quality=85)