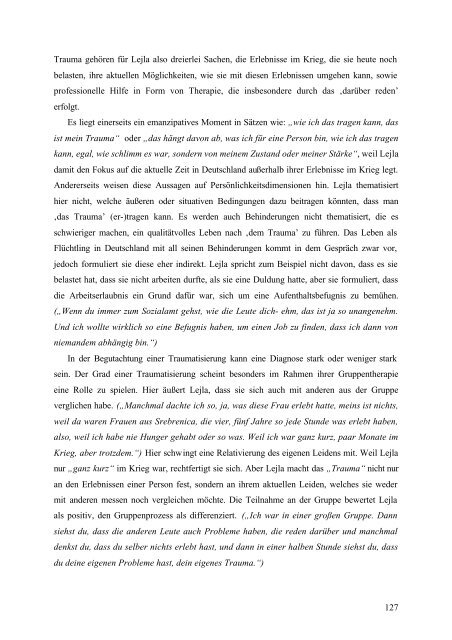vollständige Diplomarbeit - Socialnet
vollständige Diplomarbeit - Socialnet
vollständige Diplomarbeit - Socialnet
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Trauma gehören für Lejla also dreierlei Sachen, die Erlebnisse im Krieg, die sie heute noch<br />
belasten, ihre aktuellen Möglichkeiten, wie sie mit diesen Erlebnissen umgehen kann, sowie<br />
professionelle Hilfe in Form von Therapie, die insbesondere durch das ‚darüber reden’<br />
erfolgt.<br />
Es liegt einerseits ein emanzipatives Moment in Sätzen wie: „wie ich das tragen kann, das<br />
ist mein Trauma“ oder „das hängt davon ab, was ich für eine Person bin, wie ich das tragen<br />
kann, egal, wie schlimm es war, sondern von meinem Zustand oder meiner Stärke“, weil Lejla<br />
damit den Fokus auf die aktuelle Zeit in Deutschland außerhalb ihrer Erlebnisse im Krieg legt.<br />
Andererseits weisen diese Aussagen auf Persönlichkeitsdimensionen hin. Lejla thematisiert<br />
hier nicht, welche äußeren oder situativen Bedingungen dazu beitragen könnten, dass man<br />
‚das Trauma’ (er-)tragen kann. Es werden auch Behinderungen nicht thematisiert, die es<br />
schwieriger machen, ein qualitätvolles Leben nach ‚dem Trauma’ zu führen. Das Leben als<br />
Flüchtling in Deutschland mit all seinen Behinderungen kommt in dem Gespräch zwar vor,<br />
jedoch formuliert sie diese eher indirekt. Lejla spricht zum Beispiel nicht davon, dass es sie<br />
belastet hat, dass sie nicht arbeiten durfte, als sie eine Duldung hatte, aber sie formuliert, dass<br />
die Arbeitserlaubnis ein Grund dafür war, sich um eine Aufenthaltsbefugnis zu bemühen.<br />
(„Wenn du immer zum Sozialamt gehst, wie die Leute dich- ehm, das ist ja so unangenehm.<br />
Und ich wollte wirklich so eine Befugnis haben, um einen Job zu finden, dass ich dann von<br />
niemandem abhängig bin.“)<br />
In der Begutachtung einer Traumatisierung kann eine Diagnose stark oder weniger stark<br />
sein. Der Grad einer Traumatisierung scheint besonders im Rahmen ihrer Gruppentherapie<br />
eine Rolle zu spielen. Hier äußert Lejla, dass sie sich auch mit anderen aus der Gruppe<br />
verglichen habe. („Manchmal dachte ich so, ja, was diese Frau erlebt hatte, meins ist nichts,<br />
weil da waren Frauen aus Srebrenica, die vier, fünf Jahre so jede Stunde was erlebt haben,<br />
also, weil ich habe nie Hunger gehabt oder so was. Weil ich war ganz kurz, paar Monate im<br />
Krieg, aber trotzdem.“) Hier schwingt eine Relativierung des eigenen Leidens mit. Weil Lejla<br />
nur „ganz kurz“ im Krieg war, rechtfertigt sie sich. Aber Lejla macht das „Trauma“ nicht nur<br />
an den Erlebnissen einer Person fest, sondern an ihrem aktuellen Leiden, welches sie weder<br />
mit anderen messen noch vergleichen möchte. Die Teilnahme an der Gruppe bewertet Lejla<br />
als positiv, den Gruppenprozess als differenziert. („Ich war in einer großen Gruppe. Dann<br />
siehst du, dass die anderen Leute auch Probleme haben, die reden darüber und manchmal<br />
denkst du, dass du selber nichts erlebt hast, und dann in einer halben Stunde siehst du, dass<br />
du deine eigenen Probleme hast, dein eigenes Trauma.“)<br />
127