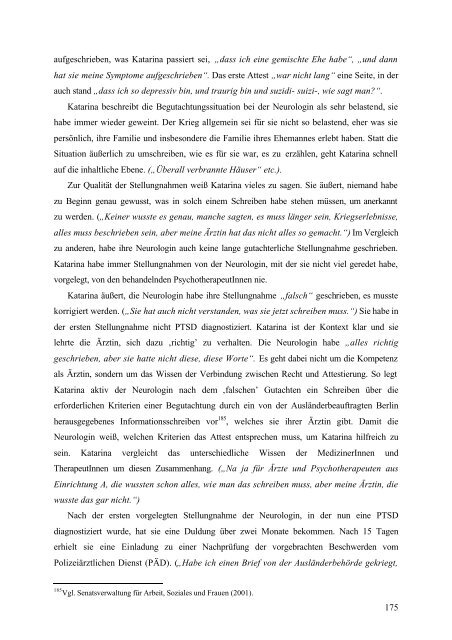vollständige Diplomarbeit - Socialnet
vollständige Diplomarbeit - Socialnet
vollständige Diplomarbeit - Socialnet
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
aufgeschrieben, was Katarina passiert sei, „dass ich eine gemischte Ehe habe“, „und dann<br />
hat sie meine Symptome aufgeschrieben“. Das erste Attest „war nicht lang“ eine Seite, in der<br />
auch stand „dass ich so depressiv bin, und traurig bin und suzidi- suizi-, wie sagt man?“.<br />
Katarina beschreibt die Begutachtungssituation bei der Neurologin als sehr belastend, sie<br />
habe immer wieder geweint. Der Krieg allgemein sei für sie nicht so belastend, eher was sie<br />
persönlich, ihre Familie und insbesondere die Familie ihres Ehemannes erlebt haben. Statt die<br />
Situation äußerlich zu umschreiben, wie es für sie war, es zu erzählen, geht Katarina schnell<br />
auf die inhaltliche Ebene. („Überall verbrannte Häuser“ etc.).<br />
Zur Qualität der Stellungnahmen weiß Katarina vieles zu sagen. Sie äußert, niemand habe<br />
zu Beginn genau gewusst, was in solch einem Schreiben habe stehen müssen, um anerkannt<br />
zu werden. („Keiner wusste es genau, manche sagten, es muss länger sein, Kriegserlebnisse,<br />
alles muss beschrieben sein, aber meine Ärztin hat das nicht alles so gemacht.“) Im Vergleich<br />
zu anderen, habe ihre Neurologin auch keine lange gutachterliche Stellungnahme geschrieben.<br />
Katarina habe immer Stellungnahmen von der Neurologin, mit der sie nicht viel geredet habe,<br />
vorgelegt, von den behandelnden PsychotherapeutInnen nie.<br />
Katarina äußert, die Neurologin habe ihre Stellungnahme „falsch“ geschrieben, es musste<br />
korrigiert werden. („Sie hat auch nicht verstanden, was sie jetzt schreiben muss.“) Sie habe in<br />
der ersten Stellungnahme nicht PTSD diagnostiziert. Katarina ist der Kontext klar und sie<br />
lehrte die Ärztin, sich dazu ‚richtig’ zu verhalten. Die Neurologin habe „alles richtig<br />
geschrieben, aber sie hatte nicht diese, diese Worte“. Es geht dabei nicht um die Kompetenz<br />
als Ärztin, sondern um das Wissen der Verbindung zwischen Recht und Attestierung. So legt<br />
Katarina aktiv der Neurologin nach dem ‚falschen’ Gutachten ein Schreiben über die<br />
erforderlichen Kriterien einer Begutachtung durch ein von der Ausländerbeauftragten Berlin<br />
herausgegebenes Informationsschreiben vor 185 , welches sie ihrer Ärztin gibt. Damit die<br />
Neurologin weiß, welchen Kriterien das Attest entsprechen muss, um Katarina hilfreich zu<br />
sein. Katarina vergleicht das unterschiedliche Wissen der MedizinerInnen und<br />
TherapeutInnen um diesen Zusammenhang. („Na ja für Ärzte und Psychotherapeuten aus<br />
Einrichtung A, die wussten schon alles, wie man das schreiben muss, aber meine Ärztin, die<br />
wusste das gar nicht.“)<br />
Nach der ersten vorgelegten Stellungnahme der Neurologin, in der nun eine PTSD<br />
diagnostiziert wurde, hat sie eine Duldung über zwei Monate bekommen. Nach 15 Tagen<br />
erhielt sie eine Einladung zu einer Nachprüfung der vorgebrachten Beschwerden vom<br />
Polizeiärztlichen Dienst (PÄD). („Habe ich einen Brief von der Ausländerbehörde gekriegt,<br />
185 Vgl. Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales und Frauen (2001).<br />
175