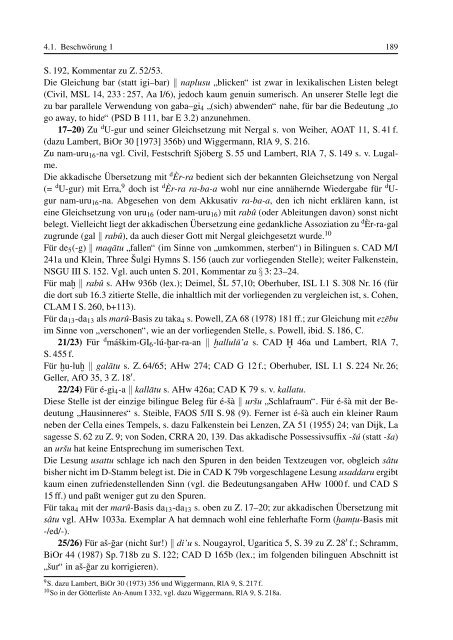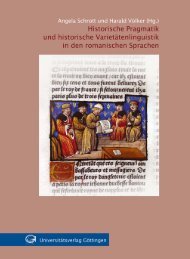Ein compendium sumerisch-akkadischer Beschwörungen
Ein compendium sumerisch-akkadischer Beschwörungen
Ein compendium sumerisch-akkadischer Beschwörungen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4.1. Beschwörung 1 189<br />
S. 192, Kommentar zu Z. 52/53.<br />
Die Gleichung bar (statt igi–bar) ‖ naplusu blicken“ ist zwar in lexikalischen Listen belegt<br />
”<br />
(Civil, MSL 14, 233 : 257, Aa I/6), jedoch kaum genuin <strong>sumerisch</strong>. An unserer Stelle legt die<br />
zu bar parallele Verwendung von gaba–gi 4<br />
” (sich) abwenden“ nahe, für bar die Bedeutung ” to<br />
go away, to hide“ (PSD B 111, bar E 3.2) anzunehmen.<br />
17–20) Zu d U-gur und seiner Gleichsetzung mit Nergal s. von Weiher, AOAT 11, S. 41 f.<br />
(dazu Lambert, BiOr 30 [1973] 356b) und Wiggermann, RlA 9, S. 216.<br />
Zu nam-uru 16 -na vgl. Civil, Festschrift Sjöberg S. 55 und Lambert, RlA 7, S. 149 s. v. Lugalme.<br />
Die akkadische Übersetzung mit d Èr-ra bedient sich der bekannten Gleichsetzung von Nergal<br />
(= d U-gur) mit Erra, 9 doch ist d Èr-ra ra-ba-a wohl nur eine annähernde Wiedergabe für d U-<br />
gur nam-uru 16 -na. Abgesehen von dem Akkusativ ra-ba-a, den ich nicht erklären kann, ist<br />
eine Gleichsetzung von uru 16 (oder nam-uru 16 ) mit rabû (oder Ableitungen davon) sonst nicht<br />
belegt. Vielleicht liegt der akkadischen Übersetzung eine gedankliche Assoziation zu d Èr-ra-gal<br />
zugrunde (gal ‖ rabû), da auch dieser Gott mit Nergal gleichgesetzt wurde. 10<br />
Für de 5 (-g) ‖ maqātu fallen“ (im Sinne von umkommen, sterben“) in Bilinguen s. CAD M/I<br />
” ”<br />
241a und Klein, Three Šulgi Hymns S. 156 (auch zur vorliegenden Stelle); weiter Falkenstein,<br />
NSGU III S. 152. Vgl. auch unten S. 201, Kommentar zu § 3: 23–24.<br />
Für ‖ rabû s. AHw 936b (lex.); Deimel, ŠL 57,10; Oberhuber, ISL I.1 S. 308 Nr. 16 (für<br />
die dort<br />
mah˘<br />
sub 16.3 zitierte Stelle, die inhaltlich mit der vorliegenden zu vergleichen ist, s. Cohen,<br />
CLAM I S. 260, b+113).<br />
Für da 13 -da 13 als marû-Basis zu taka 4 s. Powell, ZA 68 (1978) 181 ff.; zur Gleichung mit ezēbu<br />
im Sinne von verschonen“, wie an der vorliegenden Stelle, s. Powell, ibid. S. 186, C.<br />
”<br />
21/23) Für d máškim-GI 6 -lú-h˘ar-ra-an ‖ allulū’a s. CAD 46a und Lambert, RlA 7,<br />
S. 455 f.<br />
h˘<br />
H˘<br />
Für ‖ galātu s. Z. 64/65; AHw 274; CAD G 12 f.; Oberhuber, ISL I.1 S. 224 Nr. 26;<br />
Geller,<br />
h˘u-luh˘<br />
AfO 35, 3 Z. 18 ′ .<br />
22/24) Für é-gi 4 -a ‖ kallātu s. AHw 426a; CAD K 79 s. v. kallatu.<br />
Diese Stelle ist der einzige bilingue Beleg für é-šà ‖ uršu Schlafraum“. Für é-šà mit der Bedeutung<br />
Hausinneres“ s. Steible, FAOS 5/II S. 98 (9). Ferner ist é-šà auch ein kleiner Raum<br />
”<br />
”<br />
neben der Cella eines Tempels, s. dazu Falkenstein bei Lenzen, ZA 51 (1955) 24; van Dijk, La<br />
sagesse S. 62 zu Z. 9; von Soden, CRRA 20, 139. Das akkadische Possessivsuffix -šú (statt -ša)<br />
an uršu hat keine Entsprechung im <strong>sumerisch</strong>en Text.<br />
Die Lesung usattu schlage ich nach den Spuren in den beiden Textzeugen vor, obgleich sâtu<br />
bisher nicht im D-Stamm belegt ist. Die in CAD K 79b vorgeschlagene Lesung usaddaru ergibt<br />
kaum einen zufriedenstellenden Sinn (vgl. die Bedeutungsangaben AHw 1000 f. und CAD S<br />
15 ff.) und paßt weniger gut zu den Spuren.<br />
Für taka 4 mit der marû-Basis da 13 -da 13 s. oben zu Z. 17–20; zur akkadischen Übersetzung mit<br />
sâtu vgl. AHw 1033a. Exemplar A hat demnach wohl eine fehlerhafte Form amṭu-Basis mit<br />
-/ed/-).<br />
(h˘<br />
25/26) Für aš-˜gar (nicht šur!) ‖ di’u s. Nougayrol, Ugaritica 5, S. 39 zu Z. 28 ′ f.; Schramm,<br />
BiOr 44 (1987) Sp. 718b zu S. 122; CAD D 165b (lex.; im folgenden bilinguen Abschnitt ist<br />
in aš-˜gar zu korrigieren).<br />
”šur“ 9 S. dazu Lambert, BiOr 30 (1973) 356 und Wiggermann, RlA 9, S. 217 f.<br />
10 So in der Götterliste An-Anum I 332, vgl. dazu Wiggermann, RlA 9, S. 218a.