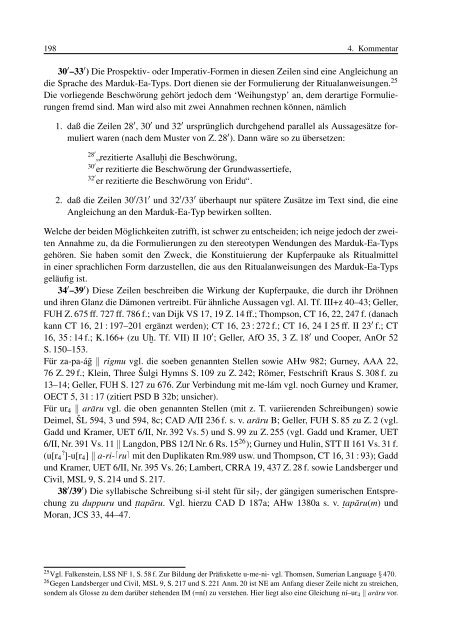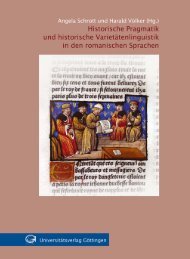Ein compendium sumerisch-akkadischer Beschwörungen
Ein compendium sumerisch-akkadischer Beschwörungen
Ein compendium sumerisch-akkadischer Beschwörungen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
198 4. Kommentar<br />
30 ′ –33 ′ ) Die Prospektiv- oder Imperativ-Formen in diesen Zeilen sind eine Angleichung an<br />
die Sprache des Marduk-Ea-Typs. Dort dienen sie der Formulierung der Ritualanweisungen. 25<br />
Die vorliegende Beschwörung gehört jedoch dem ‘Weihungstyp’ an, dem derartige Formulierungen<br />
fremd sind. Man wird also mit zwei Annahmen rechnen können, nämlich<br />
1. daß die Zeilen 28 ′ , 30 ′ und 32 ′ ursprünglich durchgehend parallel als Aussagesätze formuliert<br />
waren (nach dem Muster von Z. 28 ′ ). Dann wäre so zu übersetzen:<br />
28 ′ rezitierte Asalluh˘i die Beschwörung,<br />
30<br />
” ′<br />
er rezitierte die Beschwörung der Grundwassertiefe,<br />
32 ′ er rezitierte die Beschwörung von Eridu“.<br />
2. daß die Zeilen 30 ′ /31 ′ und 32 ′ /33 ′ überhaupt nur spätere Zusätze im Text sind, die eine<br />
Angleichung an den Marduk-Ea-Typ bewirken sollten.<br />
Welche der beiden Möglichkeiten zutrifft, ist schwer zu entscheiden; ich neige jedoch der zweiten<br />
Annahme zu, da die Formulierungen zu den stereotypen Wendungen des Marduk-Ea-Typs<br />
gehören. Sie haben somit den Zweck, die Konstituierung der Kupferpauke als Ritualmittel<br />
in einer sprachlichen Form darzustellen, die aus den Ritualanweisungen des Marduk-Ea-Typs<br />
geläufig ist.<br />
34 ′ –39 ′ ) Diese Zeilen beschreiben die Wirkung der Kupferpauke, die durch ihr Dröhnen<br />
und ihren Glanz die Dämonen vertreibt. Für ähnliche Aussagen vgl. Al. Tf. III+z 40–43; Geller,<br />
FUH Z. 675 ff. 727 ff. 786 f.; van Dijk VS 17, 19 Z. 14 ff.; Thompson, CT 16, 22, 247 f. (danach<br />
kann CT 16, 21 : 197–201 ergänzt werden); CT 16, 23 : 272 f.; CT 16, 24 I 25 ff. II 23 ′ f.; CT<br />
16, 35 : 14 f.; K.166+ (zu Uh˘. Tf. VII) II 10 ′ ; Geller, AfO 35, 3 Z. 18 ′ und Cooper, AnOr 52<br />
S. 150–153.<br />
Für za-pa-á˜g ‖ rigmu vgl. die soeben genannten Stellen sowie AHw 982; Gurney, AAA 22,<br />
76 Z. 29 f.; Klein, Three Šulgi Hymns S. 109 zu Z. 242; Römer, Festschrift Kraus S. 308 f. zu<br />
13–14; Geller, FUH S. 127 zu 676. Zur Verbindung mit me-lám vgl. noch Gurney und Kramer,<br />
OECT 5, 31 : 17 (zitiert PSD B 32b; unsicher).<br />
Für ur 4 ‖ arāru vgl. die oben genannten Stellen (mit z. T. variierenden Schreibungen) sowie<br />
Deimel, ŠL 594, 3 und 594, 8c; CAD A/II 236 f. s. v. arāru B; Geller, FUH S. 85 zu Z. 2 (vgl.<br />
Gadd und Kramer, UET 6/II, Nr. 392 Vs. 5) und S. 99 zu Z. 255 (vgl. Gadd und Kramer, UET<br />
6/II, Nr. 391 Vs. 11 ‖ Langdon, PBS 12/I Nr. 6 Rs. 15 26 ); Gurney und Hulin, STT II 161 Vs. 31 f.<br />
(u[r 4 ? ]-u[r 4 ] ‖ a-ri- ⌈ ru ⌉ mit den Duplikaten Rm.989 usw. und Thompson, CT 16, 31 : 93); Gadd<br />
und Kramer, UET 6/II, Nr. 395 Vs. 26; Lambert, CRRA 19, 437 Z. 28 f. sowie Landsberger und<br />
Civil, MSL 9, S. 214 und S. 217.<br />
38 ′ /39 ′ ) Die syllabische Schreibung si-il steht für sil 7 , der gängigen <strong>sumerisch</strong>en Entsprechung<br />
zu duppuru und ṭtapāru. Vgl. hierzu CAD D 187a; AHw 1380a s. v. ṭapāru(m) und<br />
Moran, JCS 33, 44–47.<br />
25 Vgl. Falkenstein, LSS NF 1, S. 58 f. Zur Bildung der Präfixkette u-me-ni- vgl. Thomsen, Sumerian Language § 470.<br />
26 Gegen Landsberger und Civil, MSL 9, S. 217 und S. 221 Anm. 20 ist NE am Anfang dieser Zeile nicht zu streichen,<br />
sondern als Glosse zu dem darüber stehenden IM (=ní) zu verstehen. Hier liegt also eine Gleichung ní–ur 4 ‖ arāru vor.