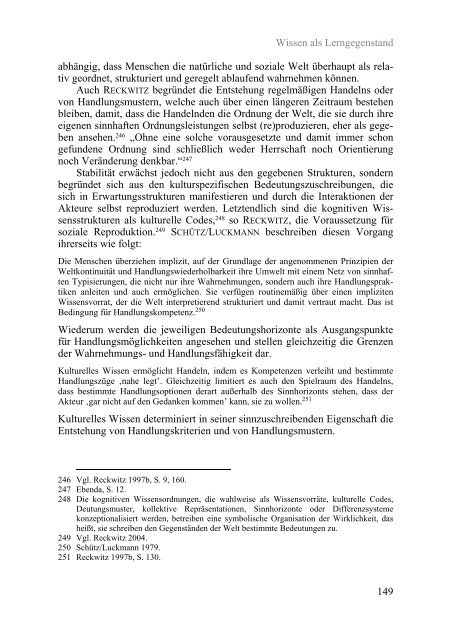Birgit Hilliger Paradigmenwechsel als Feld strukturellen ... - Budrich
Birgit Hilliger Paradigmenwechsel als Feld strukturellen ... - Budrich
Birgit Hilliger Paradigmenwechsel als Feld strukturellen ... - Budrich
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Wissen <strong>als</strong> Lerngegenstand<br />
abhängig, dass Menschen die natürliche und soziale Welt überhaupt <strong>als</strong> relativ<br />
geordnet, strukturiert und geregelt ablaufend wahrnehmen können.<br />
Auch RECKWITZ begründet die Entstehung regelmäßigen Handelns oder<br />
von Handlungsmustern, welche auch über einen längeren Zeitraum bestehen<br />
bleiben, damit, dass die Handelnden die Ordnung der Welt, die sie durch ihre<br />
eigenen sinnhaften Ordnungsleistungen selbst (re)produzieren, eher <strong>als</strong> gegeben<br />
ansehen. 246 „Ohne eine solche vorausgesetzte und damit immer schon<br />
gefundene Ordnung sind schließlich weder Herrschaft noch Orientierung<br />
noch Veränderung denkbar.“ 247<br />
Stabilität erwächst jedoch nicht aus den gegebenen Strukturen, sondern<br />
begründet sich aus den kulturspezifischen Bedeutungszuschreibungen, die<br />
sich in Erwartungsstrukturen manifestieren und durch die Interaktionen der<br />
Akteure selbst reproduziert werden. Letztendlich sind die kognitiven Wissensstrukturen<br />
<strong>als</strong> kulturelle Codes, 248 so RECKWITZ, die Voraussetzung für<br />
soziale Reproduktion. 249 SCHÜTZ/LUCKMANN beschreiben diesen Vorgang<br />
ihrerseits wie folgt:<br />
Die Menschen überziehen implizit, auf der Grundlage der angenommenen Prinzipien der<br />
Weltkontinuität und Handlungswiederholbarkeit ihre Umwelt mit einem Netz von sinnhaften<br />
Typisierungen, die nicht nur ihre Wahrnehmungen, sondern auch ihre Handlungspraktiken<br />
anleiten und auch ermöglichen. Sie verfügen routinemäßig über einen impliziten<br />
Wissensvorrat, der die Welt interpretierend strukturiert und damit vertraut macht. Das ist<br />
Bedingung für Handlungskompetenz. 250<br />
Wiederum werden die jeweiligen Bedeutungshorizonte <strong>als</strong> Ausgangspunkte<br />
für Handlungsmöglichkeiten angesehen und stellen gleichzeitig die Grenzen<br />
der Wahrnehmungs- und Handlungsfähigkeit dar.<br />
Kulturelles Wissen ermöglicht Handeln, indem es Kompetenzen verleiht und bestimmte<br />
Handlungszüge ‚nahe legt’. Gleichzeitig limitiert es auch den Spielraum des Handelns,<br />
dass bestimmte Handlungsoptionen derart außerhalb des Sinnhorizonts stehen, dass der<br />
Akteur ‚gar nicht auf den Gedanken kommen’ kann, sie zu wollen. 251<br />
Kulturelles Wissen determiniert in seiner sinnzuschreibenden Eigenschaft die<br />
Entstehung von Handlungskriterien und von Handlungsmustern.<br />
246 Vgl. Reckwitz 1997b, S. 9, 160.<br />
247 Ebenda, S. 12.<br />
248 Die kognitiven Wissensordnungen, die wahlweise <strong>als</strong> Wissensvorräte, kulturelle Codes,<br />
Deutungsmuster, kollektive Repräsentationen, Sinnhorizonte oder Differenzsysteme<br />
konzeptionalisiert werden, betreiben eine symbolische Organisation der Wirklichkeit, das<br />
heißt, sie schreiben den Gegenständen der Welt bestimmte Bedeutungen zu.<br />
249 Vgl. Reckwitz 2004.<br />
250 Schütz/Luckmann 1979.<br />
251 Reckwitz 1997b, S. 130.<br />
149