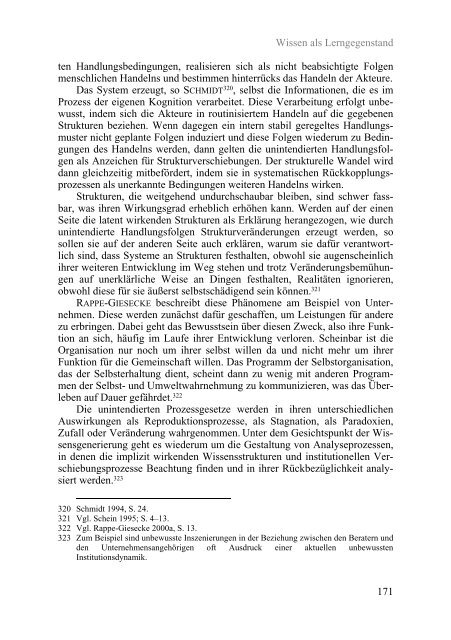Birgit Hilliger Paradigmenwechsel als Feld strukturellen ... - Budrich
Birgit Hilliger Paradigmenwechsel als Feld strukturellen ... - Budrich
Birgit Hilliger Paradigmenwechsel als Feld strukturellen ... - Budrich
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Wissen <strong>als</strong> Lerngegenstand<br />
ten Handlungsbedingungen, realisieren sich <strong>als</strong> nicht beabsichtigte Folgen<br />
menschlichen Handelns und bestimmen hinterrücks das Handeln der Akteure.<br />
Das System erzeugt, so SCHMIDT 320 , selbst die Informationen, die es im<br />
Prozess der eigenen Kognition verarbeitet. Diese Verarbeitung erfolgt unbewusst,<br />
indem sich die Akteure in routinisiertem Handeln auf die gegebenen<br />
Strukturen beziehen. Wenn dagegen ein intern stabil geregeltes Handlungsmuster<br />
nicht geplante Folgen induziert und diese Folgen wiederum zu Bedingungen<br />
des Handelns werden, dann gelten die unintendierten Handlungsfolgen<br />
<strong>als</strong> Anzeichen für Strukturverschiebungen. Der strukturelle Wandel wird<br />
dann gleichzeitig mitbefördert, indem sie in systematischen Rückkopplungsprozessen<br />
<strong>als</strong> unerkannte Bedingungen weiteren Handelns wirken.<br />
Strukturen, die weitgehend undurchschaubar bleiben, sind schwer fassbar,<br />
was ihren Wirkungsgrad erheblich erhöhen kann. Werden auf der einen<br />
Seite die latent wirkenden Strukturen <strong>als</strong> Erklärung herangezogen, wie durch<br />
unintendierte Handlungsfolgen Strukturveränderungen erzeugt werden, so<br />
sollen sie auf der anderen Seite auch erklären, warum sie dafür verantwortlich<br />
sind, dass Systeme an Strukturen festhalten, obwohl sie augenscheinlich<br />
ihrer weiteren Entwicklung im Weg stehen und trotz Veränderungsbemühungen<br />
auf unerklärliche Weise an Dingen festhalten, Realitäten ignorieren,<br />
obwohl diese für sie äußerst selbstschädigend sein können. 321<br />
RAPPE-GIESECKE beschreibt diese Phänomene am Beispiel von Unternehmen.<br />
Diese werden zunächst dafür geschaffen, um Leistungen für andere<br />
zu erbringen. Dabei geht das Bewusstsein über diesen Zweck, <strong>als</strong>o ihre Funktion<br />
an sich, häufig im Laufe ihrer Entwicklung verloren. Scheinbar ist die<br />
Organisation nur noch um ihrer selbst willen da und nicht mehr um ihrer<br />
Funktion für die Gemeinschaft willen. Das Programm der Selbstorganisation,<br />
das der Selbsterhaltung dient, scheint dann zu wenig mit anderen Programmen<br />
der Selbst- und Umweltwahrnehmung zu kommunizieren, was das Überleben<br />
auf Dauer gefährdet. 322<br />
Die unintendierten Prozessgesetze werden in ihren unterschiedlichen<br />
Auswirkungen <strong>als</strong> Reproduktionsprozesse, <strong>als</strong> Stagnation, <strong>als</strong> Paradoxien,<br />
Zufall oder Veränderung wahrgenommen. Unter dem Gesichtspunkt der Wissensgenerierung<br />
geht es wiederum um die Gestaltung von Analyseprozessen,<br />
in denen die implizit wirkenden Wissensstrukturen und institutionellen Verschiebungsprozesse<br />
Beachtung finden und in ihrer Rückbezüglichkeit analysiert<br />
werden. 323<br />
320 Schmidt 1994, S. 24.<br />
321 Vgl. Schein 1995; S. 4–13.<br />
322 Vgl. Rappe-Giesecke 2000a, S. 13.<br />
323 Zum Beispiel sind unbewusste Inszenierungen in der Beziehung zwischen den Beratern und<br />
den Unternehmensangehörigen oft Ausdruck einer aktuellen unbewussten<br />
Institutionsdynamik.<br />
171