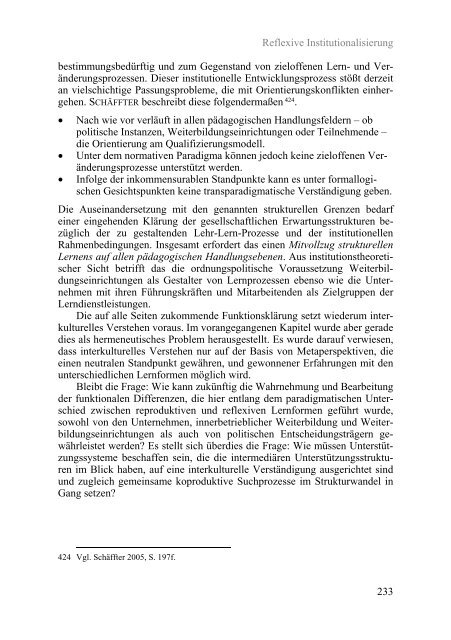Birgit Hilliger Paradigmenwechsel als Feld strukturellen ... - Budrich
Birgit Hilliger Paradigmenwechsel als Feld strukturellen ... - Budrich
Birgit Hilliger Paradigmenwechsel als Feld strukturellen ... - Budrich
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Reflexive Institutionalisierung<br />
bestimmungsbedürftig und zum Gegenstand von zieloffenen Lern- und Veränderungsprozessen.<br />
Dieser institutionelle Entwicklungsprozess stößt derzeit<br />
an vielschichtige Passungsprobleme, die mit Orientierungskonflikten einhergehen.<br />
SCHÄFFTER beschreibt diese folgendermaßen 424 .<br />
Nach wie vor verläuft in allen pädagogischen Handlungsfeldern – ob<br />
politische Instanzen, Weiterbildungseinrichtungen oder Teilnehmende –<br />
die Orientierung am Qualifizierungsmodell.<br />
Unter dem normativen Paradigma können jedoch keine zieloffenen Veränderungsprozesse<br />
unterstützt werden.<br />
Infolge der inkommensurablen Standpunkte kann es unter formallogischen<br />
Gesichtspunkten keine transparadigmatische Verständigung geben.<br />
Die Auseinandersetzung mit den genannten <strong>strukturellen</strong> Grenzen bedarf<br />
einer eingehenden Klärung der gesellschaftlichen Erwartungsstrukturen bezüglich<br />
der zu gestaltenden Lehr-Lern-Prozesse und der institutionellen<br />
Rahmenbedingungen. Insgesamt erfordert das einen Mitvollzug <strong>strukturellen</strong><br />
Lernens auf allen pädagogischen Handlungsebenen. Aus institutionstheoretischer<br />
Sicht betrifft das die ordnungspolitische Voraussetzung Weiterbildungseinrichtungen<br />
<strong>als</strong> Gestalter von Lernprozessen ebenso wie die Unternehmen<br />
mit ihren Führungskräften und Mitarbeitenden <strong>als</strong> Zielgruppen der<br />
Lerndienstleistungen.<br />
Die auf alle Seiten zukommende Funktionsklärung setzt wiederum interkulturelles<br />
Verstehen voraus. Im vorangegangenen Kapitel wurde aber gerade<br />
dies <strong>als</strong> hermeneutisches Problem herausgestellt. Es wurde darauf verwiesen,<br />
dass interkulturelles Verstehen nur auf der Basis von Metaperspektiven, die<br />
einen neutralen Standpunkt gewähren, und gewonnener Erfahrungen mit den<br />
unterschiedlichen Lernformen möglich wird.<br />
Bleibt die Frage: Wie kann zukünftig die Wahrnehmung und Bearbeitung<br />
der funktionalen Differenzen, die hier entlang dem paradigmatischen Unterschied<br />
zwischen reproduktiven und reflexiven Lernformen geführt wurde,<br />
sowohl von den Unternehmen, innerbetrieblicher Weiterbildung und Weiterbildungseinrichtungen<br />
<strong>als</strong> auch von politischen Entscheidungsträgern gewährleistet<br />
werden? Es stellt sich überdies die Frage: Wie müssen Unterstützungssysteme<br />
beschaffen sein, die die intermediären Unterstützungsstrukturen<br />
im Blick haben, auf eine interkulturelle Verständigung ausgerichtet sind<br />
und zugleich gemeinsame koproduktive Suchprozesse im Strukturwandel in<br />
Gang setzen?<br />
424 Vgl. Schäffter 2005, S. 197f.<br />
233