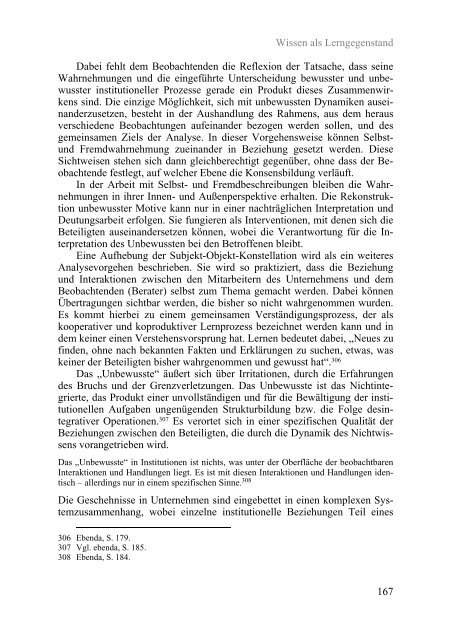Birgit Hilliger Paradigmenwechsel als Feld strukturellen ... - Budrich
Birgit Hilliger Paradigmenwechsel als Feld strukturellen ... - Budrich
Birgit Hilliger Paradigmenwechsel als Feld strukturellen ... - Budrich
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Wissen <strong>als</strong> Lerngegenstand<br />
Dabei fehlt dem Beobachtenden die Reflexion der Tatsache, dass seine<br />
Wahrnehmungen und die eingeführte Unterscheidung bewusster und unbewusster<br />
institutioneller Prozesse gerade ein Produkt dieses Zusammenwirkens<br />
sind. Die einzige Möglichkeit, sich mit unbewussten Dynamiken auseinanderzusetzen,<br />
besteht in der Aushandlung des Rahmens, aus dem heraus<br />
verschiedene Beobachtungen aufeinander bezogen werden sollen, und des<br />
gemeinsamen Ziels der Analyse. In dieser Vorgehensweise können Selbst-<br />
und Fremdwahrnehmung zueinander in Beziehung gesetzt werden. Diese<br />
Sichtweisen stehen sich dann gleichberechtigt gegenüber, ohne dass der Beobachtende<br />
festlegt, auf welcher Ebene die Konsensbildung verläuft.<br />
In der Arbeit mit Selbst- und Fremdbeschreibungen bleiben die Wahrnehmungen<br />
in ihrer Innen- und Außenperspektive erhalten. Die Rekonstruktion<br />
unbewusster Motive kann nur in einer nachträglichen Interpretation und<br />
Deutungsarbeit erfolgen. Sie fungieren <strong>als</strong> Interventionen, mit denen sich die<br />
Beteiligten auseinandersetzen können, wobei die Verantwortung für die Interpretation<br />
des Unbewussten bei den Betroffenen bleibt.<br />
Eine Aufhebung der Subjekt-Objekt-Konstellation wird <strong>als</strong> ein weiteres<br />
Analysevorgehen beschrieben. Sie wird so praktiziert, dass die Beziehung<br />
und Interaktionen zwischen den Mitarbeitern des Unternehmens und dem<br />
Beobachtenden (Berater) selbst zum Thema gemacht werden. Dabei können<br />
Übertragungen sichtbar werden, die bisher so nicht wahrgenommen wurden.<br />
Es kommt hierbei zu einem gemeinsamen Verständigungsprozess, der <strong>als</strong><br />
kooperativer und koproduktiver Lernprozess bezeichnet werden kann und in<br />
dem keiner einen Verstehensvorsprung hat. Lernen bedeutet dabei, „Neues zu<br />
finden, ohne nach bekannten Fakten und Erklärungen zu suchen, etwas, was<br />
keiner der Beteiligten bisher wahrgenommen und gewusst hat“. 306<br />
Das „Unbewusste“ äußert sich über Irritationen, durch die Erfahrungen<br />
des Bruchs und der Grenzverletzungen. Das Unbewusste ist das Nichtintegrierte,<br />
das Produkt einer unvollständigen und für die Bewältigung der institutionellen<br />
Aufgaben ungenügenden Strukturbildung bzw. die Folge desintegrativer<br />
Operationen. 307 Es verortet sich in einer spezifischen Qualität der<br />
Beziehungen zwischen den Beteiligten, die durch die Dynamik des Nichtwissens<br />
vorangetrieben wird.<br />
Das „Unbewusste“ in Institutionen ist nichts, was unter der Oberfläche der beobachtbaren<br />
Interaktionen und Handlungen liegt. Es ist mit diesen Interaktionen und Handlungen identisch<br />
– allerdings nur in einem spezifischen Sinne. 308<br />
Die Geschehnisse in Unternehmen sind eingebettet in einen komplexen Systemzusammenhang,<br />
wobei einzelne institutionelle Beziehungen Teil eines<br />
306 Ebenda, S. 179.<br />
307 Vgl. ebenda, S. 185.<br />
308 Ebenda, S. 184.<br />
167