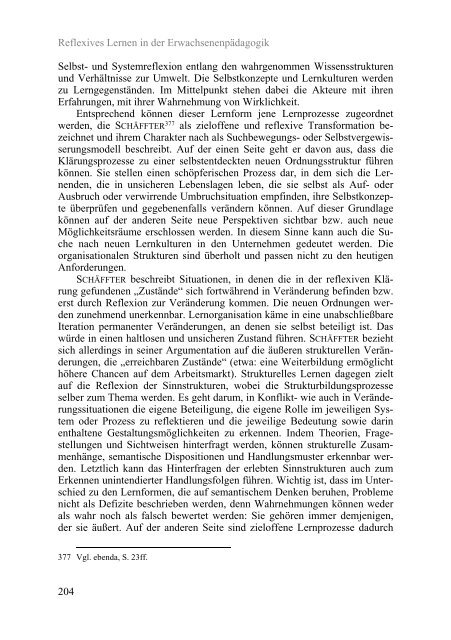Birgit Hilliger Paradigmenwechsel als Feld strukturellen ... - Budrich
Birgit Hilliger Paradigmenwechsel als Feld strukturellen ... - Budrich
Birgit Hilliger Paradigmenwechsel als Feld strukturellen ... - Budrich
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Reflexives Lernen in der Erwachsenenpädagogik<br />
Selbst- und Systemreflexion entlang den wahrgenommen Wissensstrukturen<br />
und Verhältnisse zur Umwelt. Die Selbstkonzepte und Lernkulturen werden<br />
zu Lerngegenständen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Akteure mit ihren<br />
Erfahrungen, mit ihrer Wahrnehmung von Wirklichkeit.<br />
Entsprechend können dieser Lernform jene Lernprozesse zugeordnet<br />
werden, die SCHÄFFTER 377 <strong>als</strong> zieloffene und reflexive Transformation bezeichnet<br />
und ihrem Charakter nach <strong>als</strong> Suchbewegungs- oder Selbstvergewisserungsmodell<br />
beschreibt. Auf der einen Seite geht er davon aus, dass die<br />
Klärungsprozesse zu einer selbstentdeckten neuen Ordnungsstruktur führen<br />
können. Sie stellen einen schöpferischen Prozess dar, in dem sich die Lernenden,<br />
die in unsicheren Lebenslagen leben, die sie selbst <strong>als</strong> Auf- oder<br />
Ausbruch oder verwirrende Umbruchsituation empfinden, ihre Selbstkonzepte<br />
überprüfen und gegebenenfalls verändern können. Auf dieser Grundlage<br />
können auf der anderen Seite neue Perspektiven sichtbar bzw. auch neue<br />
Möglichkeitsräume erschlossen werden. In diesem Sinne kann auch die Suche<br />
nach neuen Lernkulturen in den Unternehmen gedeutet werden. Die<br />
organisationalen Strukturen sind überholt und passen nicht zu den heutigen<br />
Anforderungen.<br />
SCHÄFFTER beschreibt Situationen, in denen die in der reflexiven Klärung<br />
gefundenen „Zustände“ sich fortwährend in Veränderung befinden bzw.<br />
erst durch Reflexion zur Veränderung kommen. Die neuen Ordnungen werden<br />
zunehmend unerkennbar. Lernorganisation käme in eine unabschließbare<br />
Iteration permanenter Veränderungen, an denen sie selbst beteiligt ist. Das<br />
würde in einen haltlosen und unsicheren Zustand führen. SCHÄFFTER bezieht<br />
sich allerdings in seiner Argumentation auf die äußeren <strong>strukturellen</strong> Veränderungen,<br />
die „erreichbaren Zustände“ (etwa: eine Weiterbildung ermöglicht<br />
höhere Chancen auf dem Arbeitsmarkt). Strukturelles Lernen dagegen zielt<br />
auf die Reflexion der Sinnstrukturen, wobei die Strukturbildungsprozesse<br />
selber zum Thema werden. Es geht darum, in Konflikt- wie auch in Veränderungssituationen<br />
die eigene Beteiligung, die eigene Rolle im jeweiligen System<br />
oder Prozess zu reflektieren und die jeweilige Bedeutung sowie darin<br />
enthaltene Gestaltungsmöglichkeiten zu erkennen. Indem Theorien, Fragestellungen<br />
und Sichtweisen hinterfragt werden, können strukturelle Zusammenhänge,<br />
semantische Dispositionen und Handlungsmuster erkennbar werden.<br />
Letztlich kann das Hinterfragen der erlebten Sinnstrukturen auch zum<br />
Erkennen unintendierter Handlungsfolgen führen. Wichtig ist, dass im Unterschied<br />
zu den Lernformen, die auf semantischem Denken beruhen, Probleme<br />
nicht <strong>als</strong> Defizite beschrieben werden, denn Wahrnehmungen können weder<br />
<strong>als</strong> wahr noch <strong>als</strong> f<strong>als</strong>ch bewertet werden: Sie gehören immer demjenigen,<br />
der sie äußert. Auf der anderen Seite sind zieloffene Lernprozesse dadurch<br />
377 Vgl. ebenda, S. 23ff.<br />
204