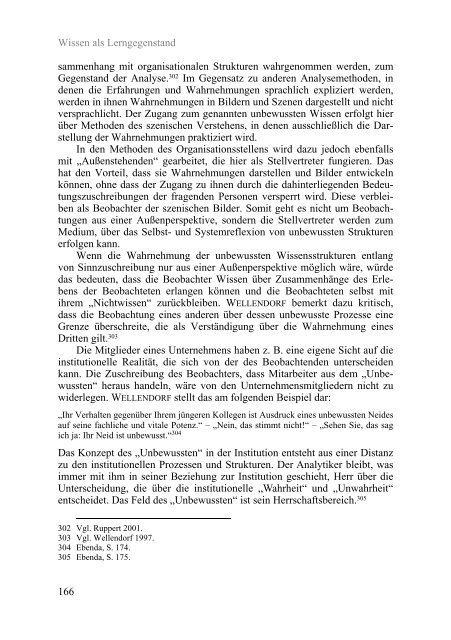Birgit Hilliger Paradigmenwechsel als Feld strukturellen ... - Budrich
Birgit Hilliger Paradigmenwechsel als Feld strukturellen ... - Budrich
Birgit Hilliger Paradigmenwechsel als Feld strukturellen ... - Budrich
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Wissen <strong>als</strong> Lerngegenstand<br />
sammenhang mit organisationalen Strukturen wahrgenommen werden, zum<br />
Gegenstand der Analyse. 302 Im Gegensatz zu anderen Analysemethoden, in<br />
denen die Erfahrungen und Wahrnehmungen sprachlich expliziert werden,<br />
werden in ihnen Wahrnehmungen in Bildern und Szenen dargestellt und nicht<br />
versprachlicht. Der Zugang zum genannten unbewussten Wissen erfolgt hier<br />
über Methoden des szenischen Verstehens, in denen ausschließlich die Darstellung<br />
der Wahrnehmungen praktiziert wird.<br />
In den Methoden des Organisationsstellens wird dazu jedoch ebenfalls<br />
mit „Außenstehenden“ gearbeitet, die hier <strong>als</strong> Stellvertreter fungieren. Das<br />
hat den Vorteil, dass sie Wahrnehmungen darstellen und Bilder entwickeln<br />
können, ohne dass der Zugang zu ihnen durch die dahinterliegenden Bedeutungszuschreibungen<br />
der fragenden Personen versperrt wird. Diese verbleiben<br />
<strong>als</strong> Beobachter der szenischen Bilder. Somit geht es nicht um Beobachtungen<br />
aus einer Außenperspektive, sondern die Stellvertreter werden zum<br />
Medium, über das Selbst- und Systemreflexion von unbewussten Strukturen<br />
erfolgen kann.<br />
Wenn die Wahrnehmung der unbewussten Wissensstrukturen entlang<br />
von Sinnzuschreibung nur aus einer Außenperspektive möglich wäre, würde<br />
das bedeuten, dass die Beobachter Wissen über Zusammenhänge des Erlebens<br />
der Beobachteten erlangen können und die Beobachteten selbst mit<br />
ihrem „Nichtwissen“ zurückbleiben. WELLENDORF bemerkt dazu kritisch,<br />
dass die Beobachtung eines anderen über dessen unbewusste Prozesse eine<br />
Grenze überschreite, die <strong>als</strong> Verständigung über die Wahrnehmung eines<br />
Dritten gilt. 303<br />
Die Mitglieder eines Unternehmens haben z. B. eine eigene Sicht auf die<br />
institutionelle Realität, die sich von der des Beobachtenden unterscheiden<br />
kann. Die Zuschreibung des Beobachters, dass Mitarbeiter aus dem „Unbewussten“<br />
heraus handeln, wäre von den Unternehmensmitgliedern nicht zu<br />
widerlegen. WELLENDORF stellt das am folgenden Beispiel dar:<br />
„Ihr Verhalten gegenüber Ihrem jüngeren Kollegen ist Ausdruck eines unbewussten Neides<br />
auf seine fachliche und vitale Potenz.“ – „Nein, das stimmt nicht!“ – „Sehen Sie, das sag<br />
ich ja: Ihr Neid ist unbewusst.“ 304<br />
Das Konzept des „Unbewussten“ in der Institution entsteht aus einer Distanz<br />
zu den institutionellen Prozessen und Strukturen. Der Analytiker bleibt, was<br />
immer mit ihm in seiner Beziehung zur Institution geschieht, Herr über die<br />
Unterscheidung, die über die institutionelle „Wahrheit“ und „Unwahrheit“<br />
entscheidet. Das <strong>Feld</strong> des „Unbewussten“ ist sein Herrschaftsbereich. 305<br />
302 Vgl. Ruppert 2001.<br />
303 Vgl. Wellendorf 1997.<br />
304 Ebenda, S. 174.<br />
305 Ebenda, S. 175.<br />
166