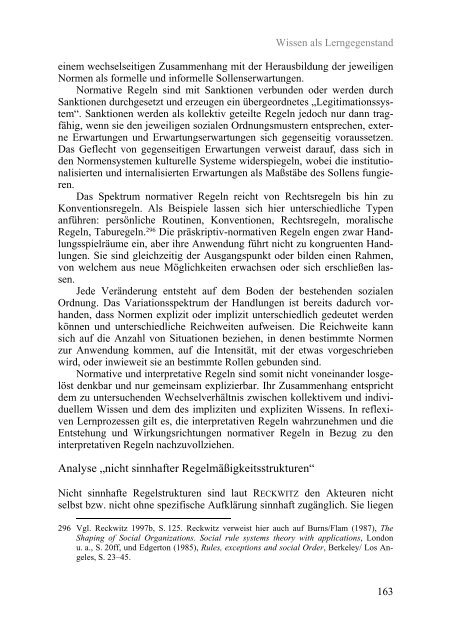Birgit Hilliger Paradigmenwechsel als Feld strukturellen ... - Budrich
Birgit Hilliger Paradigmenwechsel als Feld strukturellen ... - Budrich
Birgit Hilliger Paradigmenwechsel als Feld strukturellen ... - Budrich
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Wissen <strong>als</strong> Lerngegenstand<br />
einem wechselseitigen Zusammenhang mit der Herausbildung der jeweiligen<br />
Normen <strong>als</strong> formelle und informelle Sollenserwartungen.<br />
Normative Regeln sind mit Sanktionen verbunden oder werden durch<br />
Sanktionen durchgesetzt und erzeugen ein übergeordnetes „Legitimationssystem“.<br />
Sanktionen werden <strong>als</strong> kollektiv geteilte Regeln jedoch nur dann tragfähig,<br />
wenn sie den jeweiligen sozialen Ordnungsmustern entsprechen, externe<br />
Erwartungen und Erwartungserwartungen sich gegenseitig voraussetzen.<br />
Das Geflecht von gegenseitigen Erwartungen verweist darauf, dass sich in<br />
den Normensystemen kulturelle Systeme widerspiegeln, wobei die institutionalisierten<br />
und internalisierten Erwartungen <strong>als</strong> Maßstäbe des Sollens fungieren.<br />
Das Spektrum normativer Regeln reicht von Rechtsregeln bis hin zu<br />
Konventionsregeln. Als Beispiele lassen sich hier unterschiedliche Typen<br />
anführen: persönliche Routinen, Konventionen, Rechtsregeln, moralische<br />
Regeln, Taburegeln. 296 Die präskriptiv-normativen Regeln engen zwar Handlungsspielräume<br />
ein, aber ihre Anwendung führt nicht zu kongruenten Handlungen.<br />
Sie sind gleichzeitig der Ausgangspunkt oder bilden einen Rahmen,<br />
von welchem aus neue Möglichkeiten erwachsen oder sich erschließen lassen.<br />
Jede Veränderung entsteht auf dem Boden der bestehenden sozialen<br />
Ordnung. Das Variationsspektrum der Handlungen ist bereits dadurch vorhanden,<br />
dass Normen explizit oder implizit unterschiedlich gedeutet werden<br />
können und unterschiedliche Reichweiten aufweisen. Die Reichweite kann<br />
sich auf die Anzahl von Situationen beziehen, in denen bestimmte Normen<br />
zur Anwendung kommen, auf die Intensität, mit der etwas vorgeschrieben<br />
wird, oder inwieweit sie an bestimmte Rollen gebunden sind.<br />
Normative und interpretative Regeln sind somit nicht voneinander losgelöst<br />
denkbar und nur gemeinsam explizierbar. Ihr Zusammenhang entspricht<br />
dem zu untersuchenden Wechselverhältnis zwischen kollektivem und individuellem<br />
Wissen und dem des impliziten und expliziten Wissens. In reflexiven<br />
Lernprozessen gilt es, die interpretativen Regeln wahrzunehmen und die<br />
Entstehung und Wirkungsrichtungen normativer Regeln in Bezug zu den<br />
interpretativen Regeln nachzuvollziehen.<br />
Analyse „nicht sinnhafter Regelmäßigkeitsstrukturen“<br />
Nicht sinnhafte Regelstrukturen sind laut RECKWITZ den Akteuren nicht<br />
selbst bzw. nicht ohne spezifische Aufklärung sinnhaft zugänglich. Sie liegen<br />
296 Vgl. Reckwitz 1997b, S. 125. Reckwitz verweist hier auch auf Burns/Flam (1987), The<br />
Shaping of Social Organizations. Social rule systems theory with applications, London<br />
u. a., S. 20ff, und Edgerton (1985), Rules, exceptions and social Order, Berkeley/ Los Angeles,<br />
S. 23–45.<br />
163