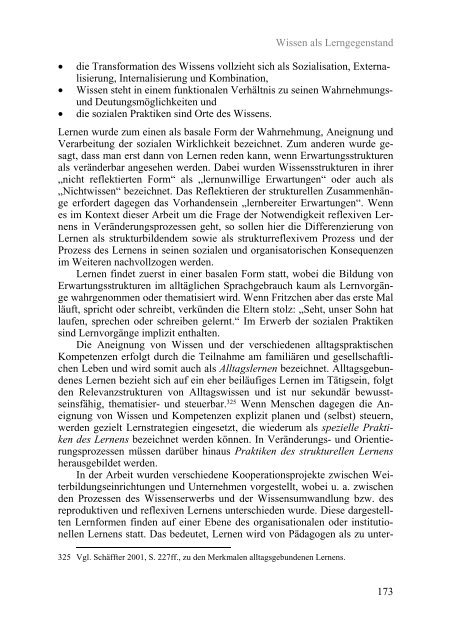Birgit Hilliger Paradigmenwechsel als Feld strukturellen ... - Budrich
Birgit Hilliger Paradigmenwechsel als Feld strukturellen ... - Budrich
Birgit Hilliger Paradigmenwechsel als Feld strukturellen ... - Budrich
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Wissen <strong>als</strong> Lerngegenstand<br />
die Transformation des Wissens vollzieht sich <strong>als</strong> Sozialisation, Externalisierung,<br />
Internalisierung und Kombination,<br />
Wissen steht in einem funktionalen Verhältnis zu seinen Wahrnehmungsund<br />
Deutungsmöglichkeiten und<br />
die sozialen Praktiken sind Orte des Wissens.<br />
Lernen wurde zum einen <strong>als</strong> basale Form der Wahrnehmung, Aneignung und<br />
Verarbeitung der sozialen Wirklichkeit bezeichnet. Zum anderen wurde gesagt,<br />
dass man erst dann von Lernen reden kann, wenn Erwartungsstrukturen<br />
<strong>als</strong> veränderbar angesehen werden. Dabei wurden Wissensstrukturen in ihrer<br />
„nicht reflektierten Form“ <strong>als</strong> „lernunwillige Erwartungen“ oder auch <strong>als</strong><br />
„Nichtwissen“ bezeichnet. Das Reflektieren der <strong>strukturellen</strong> Zusammenhänge<br />
erfordert dagegen das Vorhandensein „lernbereiter Erwartungen“. Wenn<br />
es im Kontext dieser Arbeit um die Frage der Notwendigkeit reflexiven Lernens<br />
in Veränderungsprozessen geht, so sollen hier die Differenzierung von<br />
Lernen <strong>als</strong> strukturbildendem sowie <strong>als</strong> strukturreflexivem Prozess und der<br />
Prozess des Lernens in seinen sozialen und organisatorischen Konsequenzen<br />
im Weiteren nachvollzogen werden.<br />
Lernen findet zuerst in einer basalen Form statt, wobei die Bildung von<br />
Erwartungsstrukturen im alltäglichen Sprachgebrauch kaum <strong>als</strong> Lernvorgänge<br />
wahrgenommen oder thematisiert wird. Wenn Fritzchen aber das erste Mal<br />
läuft, spricht oder schreibt, verkünden die Eltern stolz: „Seht, unser Sohn hat<br />
laufen, sprechen oder schreiben gelernt.“ Im Erwerb der sozialen Praktiken<br />
sind Lernvorgänge implizit enthalten.<br />
Die Aneignung von Wissen und der verschiedenen alltagspraktischen<br />
Kompetenzen erfolgt durch die Teilnahme am familiären und gesellschaftlichen<br />
Leben und wird somit auch <strong>als</strong> Alltagslernen bezeichnet. Alltagsgebundenes<br />
Lernen bezieht sich auf ein eher beiläufiges Lernen im Tätigsein, folgt<br />
den Relevanzstrukturen von Alltagswissen und ist nur sekundär bewusstseinsfähig,<br />
thematisier- und steuerbar. 325 Wenn Menschen dagegen die Aneignung<br />
von Wissen und Kompetenzen explizit planen und (selbst) steuern,<br />
werden gezielt Lernstrategien eingesetzt, die wiederum <strong>als</strong> spezielle Praktiken<br />
des Lernens bezeichnet werden können. In Veränderungs- und Orientierungsprozessen<br />
müssen darüber hinaus Praktiken des <strong>strukturellen</strong> Lernens<br />
herausgebildet werden.<br />
In der Arbeit wurden verschiedene Kooperationsprojekte zwischen Weiterbildungseinrichtungen<br />
und Unternehmen vorgestellt, wobei u. a. zwischen<br />
den Prozessen des Wissenserwerbs und der Wissensumwandlung bzw. des<br />
reproduktiven und reflexiven Lernens unterschieden wurde. Diese dargestellten<br />
Lernformen finden auf einer Ebene des organisationalen oder institutionellen<br />
Lernens statt. Das bedeutet, Lernen wird von Pädagogen <strong>als</strong> zu unter-<br />
325 Vgl. Schäffter 2001, S. 227ff., zu den Merkmalen alltagsgebundenen Lernens.<br />
173