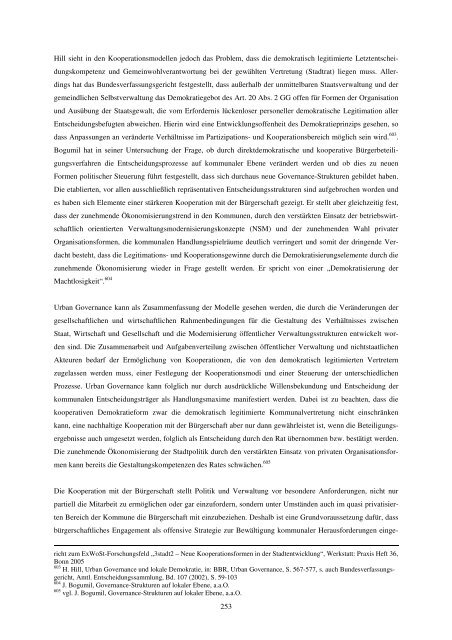Stadtentwicklung im Spannungsfeld zwischen Planung, Verwaltung ...
Stadtentwicklung im Spannungsfeld zwischen Planung, Verwaltung ...
Stadtentwicklung im Spannungsfeld zwischen Planung, Verwaltung ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Hill sieht in den Kooperationsmodellen jedoch das Problem, dass die demokratisch legit<strong>im</strong>ierte Letztentschei-<br />
dungskompetenz und Gemeinwohlverantwortung bei der gewählten Vertretung (Stadtrat) liegen muss. Aller-<br />
dings hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass außerhalb der unmittelbaren Staatsverwaltung und der<br />
gemeindlichen Selbstverwaltung das Demokratiegebot des Art. 20 Abs. 2 GG offen für Formen der Organisation<br />
und Ausübung der Staatsgewalt, die vom Erfordernis lückenloser personeller demokratische Legit<strong>im</strong>ation aller<br />
Entscheidungsbefugten abweichen. Hierin wird eine Entwicklungsoffenheit des Demokratieprinzips gesehen, so<br />
dass Anpassungen an veränderte Verhältnisse <strong>im</strong> Partizipations- und Kooperationsbereich möglich sein wird. 603 .<br />
Bogumil hat in seiner Untersuchung der Frage, ob durch direktdemokratische und kooperative Bürgerbeteili-<br />
gungsverfahren die Entscheidungsprozesse auf kommunaler Ebene verändert werden und ob dies zu neuen<br />
Formen politischer Steuerung führt festgestellt, dass sich durchaus neue Governance-Strukturen gebildet haben.<br />
Die etablierten, vor allen ausschließlich repräsentativen Entscheidungsstrukturen sind aufgebrochen worden und<br />
es haben sich Elemente einer stärkeren Kooperation mit der Bürgerschaft gezeigt. Er stellt aber gleichzeitig fest,<br />
dass der zunehmende Ökonomisierungstrend in den Kommunen, durch den verstärkten Einsatz der betriebswirt-<br />
schaftlich orientierten <strong>Verwaltung</strong>smodernisierungskonzepte (NSM) und der zunehmenden Wahl privater<br />
Organisationsformen, die kommunalen Handlungsspielräume deutlich verringert und somit der dringende Ver-<br />
dacht besteht, dass die Legit<strong>im</strong>ations- und Kooperationsgewinne durch die Demokratisierungselemente durch die<br />
zunehmende Ökonomisierung wieder in Frage gestellt werden. Er spricht von einer „Demokratisierung der<br />
Machtlosigkeit“. 604<br />
Urban Governance kann als Zusammenfassung der Modelle gesehen werden, die durch die Veränderungen der<br />
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Verhältnisses <strong>zwischen</strong><br />
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft und die Modernisierung öffentlicher <strong>Verwaltung</strong>sstrukturen entwickelt wor-<br />
den sind. Die Zusammenarbeit und Aufgabenverteilung <strong>zwischen</strong> öffentlicher <strong>Verwaltung</strong> und nichtstaatlichen<br />
Akteuren bedarf der Ermöglichung von Kooperationen, die von den demokratisch legit<strong>im</strong>ierten Vertretern<br />
zugelassen werden muss, einer Festlegung der Kooperationsmodi und einer Steuerung der unterschiedlichen<br />
Prozesse. Urban Governance kann folglich nur durch ausdrückliche Willensbekundung und Entscheidung der<br />
kommunalen Entscheidungsträger als Handlungsmax<strong>im</strong>e manifestiert werden. Dabei ist zu beachten, dass die<br />
kooperativen Demokratieform zwar die demokratisch legit<strong>im</strong>ierte Kommunalvertretung nicht einschränken<br />
kann, eine nachhaltige Kooperation mit der Bürgerschaft aber nur dann gewährleistet ist, wenn die Beteiligungs-<br />
ergebnisse auch umgesetzt werden, folglich als Entscheidung durch den Rat übernommen bzw. bestätigt werden.<br />
Die zunehmende Ökonomisierung der Stadtpolitik durch den verstärkten Einsatz von privaten Organisationsfor-<br />
men kann bereits die Gestaltungskompetenzen des Rates schwächen. 605<br />
Die Kooperation mit der Bürgerschaft stellt Politik und <strong>Verwaltung</strong> vor besondere Anforderungen, nicht nur<br />
partiell die Mitarbeit zu ermöglichen oder gar einzufordern, sondern unter Umständen auch <strong>im</strong> quasi privatisier-<br />
ten Bereich der Kommune die Bürgerschaft mit einzubeziehen. Deshalb ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass<br />
bürgerschaftliches Engagement als offensive Strategie zur Bewältigung kommunaler Herausforderungen einge-<br />
richt zum ExWoSt-Forschungsfeld „3stadt2 – Neue Kooperationsformen in der <strong>Stadtentwicklung</strong>“, Werkstatt: Praxis Heft 36,<br />
Bonn 2005<br />
603 H. Hill, Urban Governance und lokale Demokratie, in: BBR, Urban Governance, S. 567-577, s. auch Bundesverfassungsgericht,<br />
Amtl. Entscheidungssammlung, Bd. 107 (2002), S. 59-103<br />
604 J. Bogumil, Governance-Strukturen auf lokaler Ebene, a.a.O.<br />
605 vgl. J. Bogumil, Governance-Strukturen auf lokaler Ebene, a.a.O.<br />
253