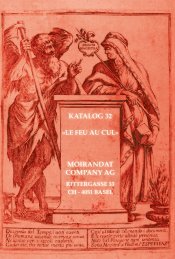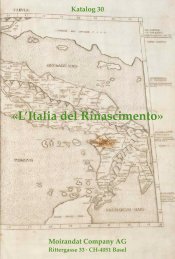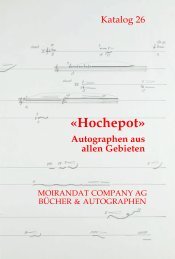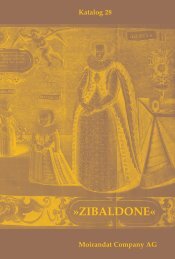- Seite 1 und 2:
I. Literatur 1 ANDERSEN, HANS CHRIS
- Seite 3 und 4:
aber die russische Anekdote von der
- Seite 5 und 6:
Bewahre Dir Gott den Kindersinn! Da
- Seite 7 und 8:
Nr. 15 Bettina von Arnim 16 ARNIM,
- Seite 9 und 10:
18 - ORIOLA,MAXIMILIANE („Maxe“
- Seite 11 und 12:
Baden-Baden 16.II.1963, nach dem To
- Seite 13 und 14:
24* BENN, GOTTFRIED, 1886-1956. L.A
- Seite 15 und 16:
gen, den ich bestellt hatte für Re
- Seite 17 und 18:
Auf dem Vorsatzblatt (leicht gebrä
- Seite 19 und 20:
Nr. 34 Johann Jakob Bodmer Nr. 35 J
- Seite 21 und 22:
Nr. 37 Bertolt Brecht 27
- Seite 23 und 24:
ist mir auch noch oft so, daß es m
- Seite 25 und 26:
41 - BRENTANO, SOPHIE, geb. Schubar
- Seite 27 und 28:
„Ähnlichkeit mit meinem Freunde
- Seite 29 und 30:
„Ein Schwabenmädel ...“ 48 BÜ
- Seite 31 und 32:
Da hat man noch bei nichts Was bei;
- Seite 33 und 34:
58 CANETTI, ELIAS, aus Bulgarien ge
- Seite 35 und 36:
24.XI.1946: „… A ma profonde co
- Seite 37 und 38:
Die aus reichem Elternhaus stammend
- Seite 39 und 40:
„Auf die mächtige Schützengrabe
- Seite 41 und 42:
Beiliegend ein Faksimile des Gedich
- Seite 43 und 44:
gonflent, si vos bras se raidissent
- Seite 45 und 46:
88 DÜRRENMATT, FRIEDRICH, Schweize
- Seite 47 und 48:
Mit dem Rolls durch die Wüste 94 E
- Seite 49 und 50:
Non l’épouvante du pauvre artist
- Seite 51 und 52:
99 FOCK, GORCH, Pseudonym für Joha
- Seite 53 und 54:
101 FONTANE, THEODOR, 1819-1898. L.
- Seite 55 und 56:
108 FREYTAG, GUSTAV, 1816-1895. L.A
- Seite 57 und 58:
An „Verehrteste Frau Baronin“.
- Seite 59 und 60:
kampf von 1968; er erwähnt den Wat
- Seite 61 und 62:
An seinen Freund und Übersetzer, d
- Seite 63 und 64:
Nr. 123 Johann Wolfgang von Goethe
- Seite 65 und 66:
Goethe hatte 1787 in Rom sein Stüc
- Seite 67 und 68:
Goethe auf dem Land 129 GOETHE, JOH
- Seite 69 und 70:
Beigeheftet eine „Copia“ (1 Ein
- Seite 71 und 72:
„nach und nach“ 137 - GOETHE, C
- Seite 73 und 74:
Sibylle Mertens-Schaaffhausen (1797
- Seite 75 und 76:
An einen Hofrat in Weimar, Sendunge
- Seite 77 und 78:
In Schillers Auftrag? 152 GOETHEKRE
- Seite 79 und 80:
„... Ich ... kan ... einstweilen
- Seite 81 und 82:
164 - FRITSCH, KARL WILHELM FREIHER
- Seite 83 und 84:
An ihren Vetter Wilhelm von Wolzoge
- Seite 85 und 86:
An „Liebe Bertha“ mit Nachricht
- Seite 87 und 88:
„Pour Sa Majesté l’Impératric
- Seite 89 und 90:
185 - OESER, ADAM FRIEDRICH, Maler,
- Seite 91 und 92:
193 - SCHÖNEMANN, ANNA ELISABETH,
- Seite 93 und 94:
197 - STEIN, CHARLOTTE VON, geb. vo
- Seite 95 und 96:
Gedichthandschriften von Marianne v
- Seite 97 und 98:
Daß der ‘Verschwender’ Dero Be
- Seite 99 und 100:
211 GRILLPARZER, FRANZ, 1791-1872.
- Seite 101 und 102:
217 HANDKE, PETER, österreichische
- Seite 103 und 104:
224 HAUSMANN, MANFRED, 1898-1986. 2
- Seite 105 und 106:
„ich wollt es wäre wahr“ 231 H
- Seite 107 und 108:
234 HERDER, JOHANN GOTTFRIED, deuts
- Seite 109 und 110:
30.I.1918. 1 Doppelblatt kl.-4°, d
- Seite 111 und 112:
Schwyzer Komponist Otmar Schoeck ge
- Seite 113 und 114:
246 HESSE, HERMANN, 1877-1962. L.A.
- Seite 115 und 116:
Daß er lustig werde von hinten und
- Seite 117 und 118:
das ganze tragende Metapher (Bühne
- Seite 119 und 120:
Victor Hugo war während seines zwa
- Seite 121 und 122:
Da kam ein Fotoapparat den gleich s
- Seite 123 und 124:
„ich hatte mir das Alter behaglic
- Seite 125 und 126:
274 KARSCH, ANNA LUISE, geb. Dürba
- Seite 127 und 128:
An eine Dame in Los Angeles, der si
- Seite 129 und 130:
Vom Rütli flooch ein stiller Postk
- Seite 131 und 132:
285 KLABUND, Pseudonym für Alfred
- Seite 133 und 134:
289 KÖRNER, CHRISTIAN GOTTFRIED, J
- Seite 135 und 136:
294 KOLB, ANNETTE, 1870-1967. L.A.S
- Seite 137 und 138:
Kraus in scharfen Worten polemisier
- Seite 139 und 140:
hig gewesen wäre den la Roche hier
- Seite 141 und 142:
Mensch ist Genie, ist Wunderthäter
- Seite 143 und 144: 307 LERSÉ, FRANZ CHRISTIAN, Erzieh
- Seite 145 und 146: 310 LICHTENBERG, GEORG CHRISTOPH, 1
- Seite 147 und 148: Wer fühlt nicht hohe an menschlich
- Seite 149 und 150: Genf 29.IX.1934; interessante Ausf
- Seite 151 und 152: Von Es kommt der Tag existiert dies
- Seite 153 und 154: Das deutsche Volk ist in diesem Kri
- Seite 155 und 156: Meine Jugend, so darf ich sagen, hi
- Seite 157 und 158: 332 MANN, THOMAS, 1875-1955. C.P.A.
- Seite 159 und 160: „Aber wirklich erlebt ist Alles!
- Seite 161 und 162: 341 MEYER, CONRAD FERDINAND, 1825-1
- Seite 163 und 164: 346 MONTHERLANT, HENRY DE, französ
- Seite 165 und 166: Du wunderst Dich dass mich Gena“
- Seite 167 und 168: 354 MUSIL, ROBERT, 1880-1942. Eigen
- Seite 169 und 170: Bei Samuel unter Nr. 44 mit kleiner
- Seite 171 und 172: „En 75 révolte en Herzégovine
- Seite 173 und 174: „le régime est moins puissant qu
- Seite 175 und 176: 369 RAMUZ, CHARLES FERDINAND, 1878-
- Seite 177 und 178: Freundschaftlicher Brief an Auguste
- Seite 179 und 180: 377 RILKE, RAINER MARIA, 1875-1926.
- Seite 181 und 182: „Es gibt nur - die Liebe“ 381 R
- Seite 183 und 184: 384 RINGELNATZ, JOACHIM, 1883-1934.
- Seite 185 und 186: Je vous prierai aussi de ne pas me
- Seite 187 und 188: gestaltet haben, sondern auch dort,
- Seite 189 und 190: zumindest Ausnahmen geben müsse :
- Seite 191 und 192: vente de la grande bastide de Sauma
- Seite 193: 407 SARTRE, JEAN-PAUL, französisch
- Seite 197 und 198: 415 SCHLEGEL, AUGUST WILHELM VON, 1
- Seite 199 und 200: 418 SCHLEGEL, FRIEDRICH VON, 1772-1
- Seite 201 und 202: Inhaltsreicher Brief an einen Freun
- Seite 203 und 204: 429 SCOTT, SIR WALTER, 1771-1832. L
- Seite 205 und 206: „nothing more horrible can be ima
- Seite 207 und 208: „Ich entschuldige mich für die e
- Seite 209 und 210: der zu mir. Unterhaltung mit gebild
- Seite 211 und 212: „… Quant à ma dépense si mon
- Seite 213 und 214: „die größte Wonne“ 449 STORM,
- Seite 215 und 216: Im Jahre 1902 findet in Wien die In
- Seite 217 und 218: „christean brethren of which they
- Seite 219 und 220: 467 VALÉRY, PAUL, französischer L
- Seite 221 und 222: … Mich dünkt, die Auffindung des
- Seite 223 und 224: „quelque argent, si minime qu’i
- Seite 225 und 226: Aus dem Begleitbrief ist ersichtlic
- Seite 227 und 228: 485 WEISSE, CHRISTIAN FELIX, 1726-1
- Seite 229 und 230: (Venedig) 24.V.1937 und o.J. (jedoc
- Seite 231 und 232: eines literarischen Tribunals zu er
- Seite 233 und 234: An den Dichter Johann Ernst Wagner
- Seite 235 und 236: 502 ZOLA, ÉMILE, 1840-1902. Eigenh
- Seite 237 und 238: 507 ZWEIG, STEFAN, 1881-1942. L.A.S