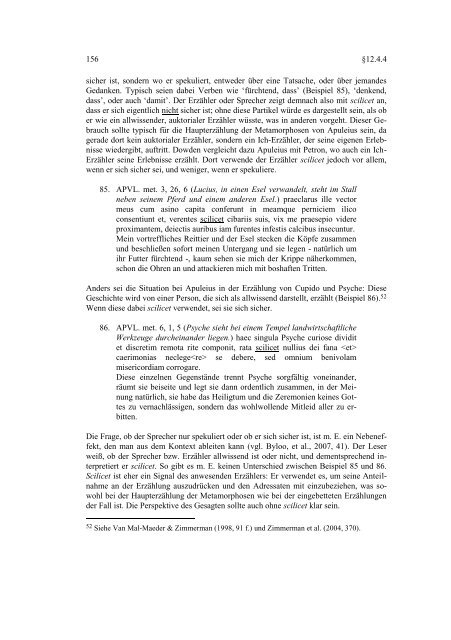Lateinische epistemische Partikeln - VU-DARE Home - Vrije ...
Lateinische epistemische Partikeln - VU-DARE Home - Vrije ...
Lateinische epistemische Partikeln - VU-DARE Home - Vrije ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
156 §12.4.4<br />
sicher ist, sondern wo er spekuliert, entweder über eine Tatsache, oder über jemandes<br />
Gedanken. Typisch seien dabei Verben wie „fürchtend, dass‟ (Beispiel 85), „denkend,<br />
dass‟, oder auch „damit‟. Der Erzähler oder Sprecher zeigt demnach also mit scilicet an,<br />
dass er sich eigentlich nicht sicher ist; ohne diese Partikel würde es dargestellt sein, als ob<br />
er wie ein allwissender, auktorialer Erzähler wüsste, was in anderen vorgeht. Dieser Gebrauch<br />
sollte typisch für die Haupterzählung der Metamorphosen von Apuleius sein, da<br />
gerade dort kein auktorialer Erzähler, sondern ein Ich-Erzähler, der seine eigenen Erlebnisse<br />
wiedergibt, auftritt. Dowden vergleicht dazu Apuleius mit Petron, wo auch ein Ich-<br />
Erzähler seine Erlebnisse erzählt. Dort verwende der Erzähler scilicet jedoch vor allem,<br />
wenn er sich sicher sei, und weniger, wenn er spekuliere.<br />
85. APVL. met. 3, 26, 6 (Lucius, in einen Esel verwandelt, steht im Stall<br />
neben seinem Pferd und einem anderen Esel.) praeclarus ille vector<br />
meus cum asino capita conferunt in meamque perniciem ilico<br />
consentiunt et, verentes scilicet cibariis suis, vix me praesepio videre<br />
proximantem, deiectis auribus iam furentes infestis calcibus insecuntur.<br />
Mein vortreffliches Reittier und der Esel stecken die Köpfe zusammen<br />
und beschließen sofort meinen Untergang und sie legen - natürlich um<br />
ihr Futter fürchtend -, kaum sehen sie mich der Krippe näherkommen,<br />
schon die Ohren an und attackieren mich mit boshaften Tritten.<br />
Anders sei die Situation bei Apuleius in der Erzählung von Cupido und Psyche: Diese<br />
Geschichte wird von einer Person, die sich als allwissend darstellt, erzählt (Beispiel 86). 52<br />
Wenn diese dabei scilicet verwendet, sei sie sich sicher.<br />
86. APVL. met. 6, 1, 5 (Psyche sieht bei einem Tempel landwirtschaftliche<br />
Werkzeuge durcheinander liegen.) haec singula Psyche curiose dividit<br />
et discretim remota rite componit, rata scilicet nullius dei fana <br />
caerimonias neclege se debere, sed omnium benivolam<br />
misericordiam corrogare.<br />
Diese einzelnen Gegenstände trennt Psyche sorgfältig voneinander,<br />
räumt sie beiseite und legt sie dann ordentlich zusammen, in der Meinung<br />
natürlich, sie habe das Heiligtum und die Zeremonien keines Gottes<br />
zu vernachlässigen, sondern das wohlwollende Mitleid aller zu erbitten.<br />
Die Frage, ob der Sprecher nur spekuliert oder ob er sich sicher ist, ist m. E. ein Nebeneffekt,<br />
den man aus dem Kontext ableiten kann (vgl. Byloo, et al., 2007, 41). Der Leser<br />
weiß, ob der Sprecher bzw. Erzähler allwissend ist oder nicht, und dementsprechend interpretiert<br />
er scilicet. So gibt es m. E. keinen Unterschied zwischen Beispiel 85 und 86.<br />
Scilicet ist eher ein Signal des anwesenden Erzählers: Er verwendet es, um seine Anteilnahme<br />
an der Erzählung auszudrücken und den Adressaten mit einzubeziehen, was sowohl<br />
bei der Haupterzählung der Metamorphosen wie bei der eingebetteten Erzählungen<br />
der Fall ist. Die Perspektive des Gesagten sollte auch ohne scilicet klar sein.<br />
52 Siehe Van Mal-Maeder & Zimmerman (1998, 91 f.) und Zimmerman et al. (2004, 370).