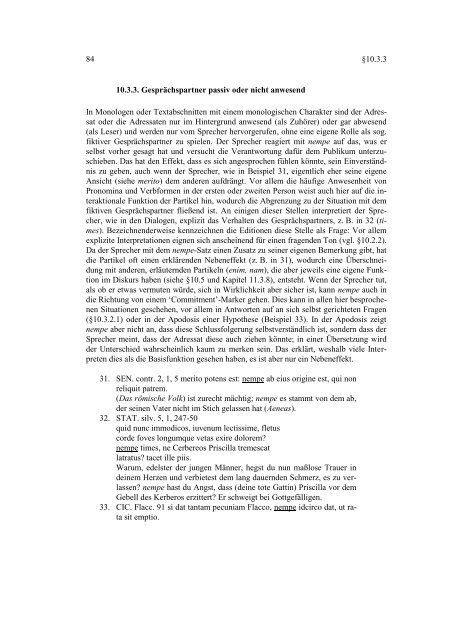Lateinische epistemische Partikeln - VU-DARE Home - Vrije ...
Lateinische epistemische Partikeln - VU-DARE Home - Vrije ...
Lateinische epistemische Partikeln - VU-DARE Home - Vrije ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
84<br />
§10.3.3<br />
10.3.3. Gesprächspartner passiv oder nicht anwesend<br />
In Monologen oder Textabschnitten mit einem monologischen Charakter sind der Adressat<br />
oder die Adressaten nur im Hintergrund anwesend (als Zuhörer) oder gar abwesend<br />
(als Leser) und werden nur vom Sprecher hervorgerufen, ohne eine eigene Rolle als sog.<br />
fiktiver Gesprächspartner zu spielen. Der Sprecher reagiert mit nempe auf das, was er<br />
selbst vorher gesagt hat und versucht die Verantwortung dafür dem Publikum unterzuschieben.<br />
Das hat den Effekt, dass es sich angesprochen fühlen könnte, sein Einverständnis<br />
zu geben, auch wenn der Sprecher, wie in Beispiel 31, eigentlich eher seine eigene<br />
Ansicht (siehe merito) dem anderen aufdrängt. Vor allem die häufige Anwesenheit von<br />
Pronomina und Verbformen in der ersten oder zweiten Person weist auch hier auf die interaktionale<br />
Funktion der Partikel hin, wodurch die Abgrenzung zu der Situation mit dem<br />
fiktiven Gesprächspartner fließend ist. An einigen dieser Stellen interpretiert der Sprecher,<br />
wie in den Dialogen, explizit das Verhalten des Gesprächspartners, z. B. in 32 (times).<br />
Bezeichnenderweise kennzeichnen die Editionen diese Stelle als Frage: Vor allem<br />
explizite Interpretationen eignen sich anscheinend für einen fragenden Ton (vgl. §10.2.2).<br />
Da der Sprecher mit dem nempe-Satz einen Zusatz zu seiner eigenen Bemerkung gibt, hat<br />
die Partikel oft einen erklärenden Nebeneffekt (z. B. in 31), wodurch eine Überschneidung<br />
mit anderen, erläuternden <strong>Partikeln</strong> (enim, nam), die aber jeweils eine eigene Funktion<br />
im Diskurs haben (siehe §10.5 und Kapitel 11.3.8), entsteht. Wenn der Sprecher tut,<br />
als ob er etwas vermuten würde, sich in Wirklichkeit aber sicher ist, kann nempe auch in<br />
die Richtung von einem „Commitment‟-Marker gehen. Dies kann in allen hier besprochenen<br />
Situationen geschehen, vor allem in Antworten auf an sich selbst gerichteten Fragen<br />
(§10.3.2.1) oder in der Apodosis einer Hypothese (Beispiel 33). In der Apodosis zeigt<br />
nempe aber nicht an, dass diese Schlussfolgerung selbstverständlich ist, sondern dass der<br />
Sprecher meint, dass der Adressat diese auch ziehen könnte; in einer Übersetzung wird<br />
der Unterschied wahrscheinlich kaum zu merken sein. Das erklärt, weshalb viele Interpreten<br />
dies als die Basisfunktion gesehen haben, es ist aber nur ein Nebeneffekt.<br />
31. SEN. contr. 2, 1, 5 merito potens est: nempe ab eius origine est, qui non<br />
reliquit patrem.<br />
(Das römische Volk) ist zurecht mächtig; nempe es stammt von dem ab,<br />
der seinen Vater nicht im Stich gelassen hat (Aeneas).<br />
32. STAT. silv. 5, 1, 247-50<br />
quid nunc immodicos, iuvenum lectissime, fletus<br />
corde foves longumque vetas exire dolorem?<br />
nempe times, ne Cerbereos Priscilla tremescat<br />
latratus? tacet ille piis.<br />
Warum, edelster der jungen Männer, hegst du nun maßlose Trauer in<br />
deinem Herzen und verbietest dem lang dauernden Schmerz, es zu verlassen?<br />
nempe hast du Angst, dass (deine tote Gattin) Priscilla vor dem<br />
Gebell des Kerberos erzittert? Er schweigt bei Gottgefälligen.<br />
33. CIC. Flacc. 91 si dat tantam pecuniam Flacco, nempe idcirco dat, ut rata<br />
sit emptio.