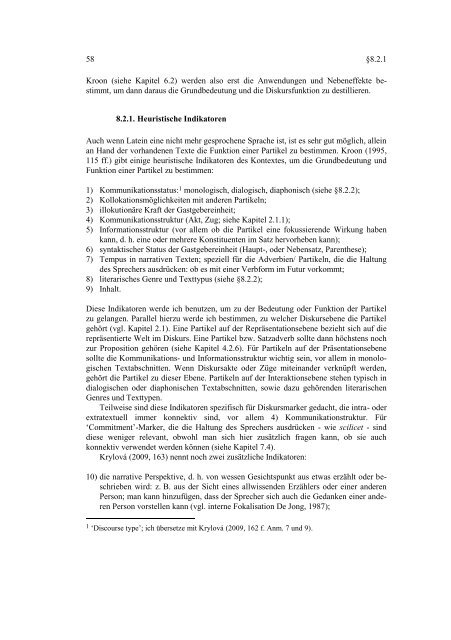Lateinische epistemische Partikeln - VU-DARE Home - Vrije ...
Lateinische epistemische Partikeln - VU-DARE Home - Vrije ...
Lateinische epistemische Partikeln - VU-DARE Home - Vrije ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
58<br />
§8.2.1<br />
Kroon (siehe Kapitel 6.2) werden also erst die Anwendungen und Nebeneffekte bestimmt,<br />
um dann daraus die Grundbedeutung und die Diskursfunktion zu destillieren.<br />
8.2.1. Heuristische Indikatoren<br />
Auch wenn Latein eine nicht mehr gesprochene Sprache ist, ist es sehr gut möglich, allein<br />
an Hand der vorhandenen Texte die Funktion einer Partikel zu bestimmen. Kroon (1995,<br />
115 ff.) gibt einige heuristische Indikatoren des Kontextes, um die Grundbedeutung und<br />
Funktion einer Partikel zu bestimmen:<br />
1) Kommunikationsstatus: 1 monologisch, dialogisch, diaphonisch (siehe §8.2.2);<br />
2) Kollokationsmöglichkeiten mit anderen <strong>Partikeln</strong>;<br />
3) illokutionäre Kraft der Gastgebereinheit;<br />
4) Kommunikationsstruktur (Akt, Zug; siehe Kapitel 2.1.1);<br />
5) Informationsstruktur (vor allem ob die Partikel eine fokussierende Wirkung haben<br />
kann, d. h. eine oder mehrere Konstituenten im Satz hervorheben kann);<br />
6) syntaktischer Status der Gastgebereinheit (Haupt-, oder Nebensatz, Parenthese);<br />
7) Tempus in narrativen Texten; speziell für die Adverbien/ <strong>Partikeln</strong>, die die Haltung<br />
des Sprechers ausdrücken: ob es mit einer Verbform im Futur vorkommt;<br />
8) literarisches Genre und Texttypus (siehe §8.2.2);<br />
9) Inhalt.<br />
Diese Indikatoren werde ich benutzen, um zu der Bedeutung oder Funktion der Partikel<br />
zu gelangen. Parallel hierzu werde ich bestimmen, zu welcher Diskursebene die Partikel<br />
gehört (vgl. Kapitel 2.1). Eine Partikel auf der Repräsentationsebene bezieht sich auf die<br />
repräsentierte Welt im Diskurs. Eine Partikel bzw. Satzadverb sollte dann höchstens noch<br />
zur Proposition gehören (siehe Kapitel 4.2.6). Für <strong>Partikeln</strong> auf der Präsentationsebene<br />
sollte die Kommunikations- und Informationsstruktur wichtig sein, vor allem in monologischen<br />
Textabschnitten. Wenn Diskursakte oder Züge miteinander verknüpft werden,<br />
gehört die Partikel zu dieser Ebene. <strong>Partikeln</strong> auf der Interaktionsebene stehen typisch in<br />
dialogischen oder diaphonischen Textabschnitten, sowie dazu gehörenden literarischen<br />
Genres und Texttypen.<br />
Teilweise sind diese Indikatoren spezifisch für Diskursmarker gedacht, die intra- oder<br />
extratextuell immer konnektiv sind, vor allem 4) Kommunikationstruktur. Für<br />
„Commitment‟-Marker, die die Haltung des Sprechers ausdrücken - wie scilicet - sind<br />
diese weniger relevant, obwohl man sich hier zusätzlich fragen kann, ob sie auch<br />
konnektiv verwendet werden können (siehe Kapitel 7.4).<br />
Krylová (2009, 163) nennt noch zwei zusätzliche Indikatoren:<br />
10) die narrative Perspektive, d. h. von wessen Gesichtspunkt aus etwas erzählt oder beschrieben<br />
wird: z. B. aus der Sicht eines allwissenden Erzählers oder einer anderen<br />
Person; man kann hinzufügen, dass der Sprecher sich auch die Gedanken einer anderen<br />
Person vorstellen kann (vgl. interne Fokalisation De Jong, 1987);<br />
1 „Discourse type‟; ich übersetze mit Krylová (2009, 162 f. Anm. 7 und 9).