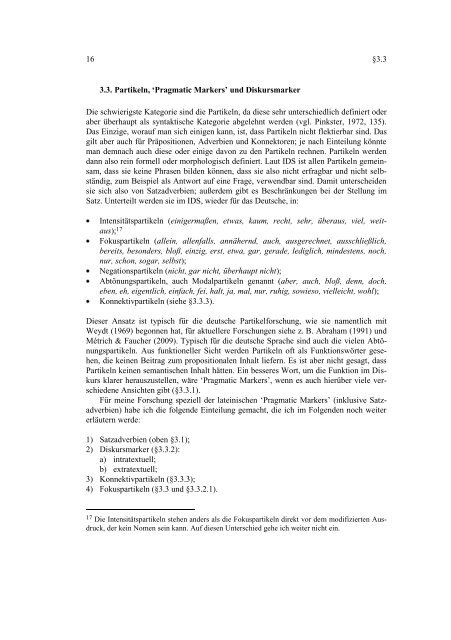Lateinische epistemische Partikeln - VU-DARE Home - Vrije ...
Lateinische epistemische Partikeln - VU-DARE Home - Vrije ...
Lateinische epistemische Partikeln - VU-DARE Home - Vrije ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
16<br />
§3.3<br />
3.3. <strong>Partikeln</strong>, ‘Pragmatic Markers’ und Diskursmarker<br />
Die schwierigste Kategorie sind die <strong>Partikeln</strong>, da diese sehr unterschiedlich definiert oder<br />
aber überhaupt als syntaktische Kategorie abgelehnt werden (vgl. Pinkster, 1972, 135).<br />
Das Einzige, worauf man sich einigen kann, ist, dass <strong>Partikeln</strong> nicht flektierbar sind. Das<br />
gilt aber auch für Präpositionen, Adverbien und Konnektoren; je nach Einteilung könnte<br />
man demnach auch diese oder einige davon zu den <strong>Partikeln</strong> rechnen. <strong>Partikeln</strong> werden<br />
dann also rein formell oder morphologisch definiert. Laut IDS ist allen <strong>Partikeln</strong> gemeinsam,<br />
dass sie keine Phrasen bilden können, dass sie also nicht erfragbar und nicht selbständig,<br />
zum Beispiel als Antwort auf eine Frage, verwendbar sind. Damit unterscheiden<br />
sie sich also von Satzadverbien; außerdem gibt es Beschränkungen bei der Stellung im<br />
Satz. Unterteilt werden sie im IDS, wieder für das Deutsche, in:<br />
Intensitätspartikeln (einigermaßen, etwas, kaum, recht, sehr, überaus, viel, weitaus);<br />
17<br />
Fokuspartikeln (allein, allenfalls, annähernd, auch, ausgerechnet, ausschließlich,<br />
bereits, besonders, bloß, einzig, erst, etwa, gar, gerade, lediglich, mindestens, noch,<br />
nur, schon, sogar, selbst);<br />
Negationspartikeln (nicht, gar nicht, überhaupt nicht);<br />
Abtönungspartikeln, auch Modalpartikeln genannt (aber, auch, bloß, denn, doch,<br />
eben, eh, eigentlich, einfach, fei, halt, ja, mal, nur, ruhig, sowieso, vielleicht, wohl);<br />
Konnektivpartikeln (siehe §3.3.3).<br />
Dieser Ansatz ist typisch für die deutsche Partikelforschung, wie sie namentlich mit<br />
Weydt (1969) begonnen hat, für aktuellere Forschungen siehe z. B. Abraham (1991) und<br />
Métrich & Faucher (2009). Typisch für die deutsche Sprache sind auch die vielen Abtönungspartikeln.<br />
Aus funktioneller Sicht werden <strong>Partikeln</strong> oft als Funktionswörter gesehen,<br />
die keinen Beitrag zum propositionalen Inhalt liefern. Es ist aber nicht gesagt, dass<br />
<strong>Partikeln</strong> keinen semantischen Inhalt hätten. Ein besseres Wort, um die Funktion im Diskurs<br />
klarer herauszustellen, wäre „Pragmatic Markers‟, wenn es auch hierüber viele verschiedene<br />
Ansichten gibt (§3.3.1).<br />
Für meine Forschung speziell der lateinischen „Pragmatic Markers‟ (inklusive Satzadverbien)<br />
habe ich die folgende Einteilung gemacht, die ich im Folgenden noch weiter<br />
erläutern werde:<br />
1) Satzadverbien (oben §3.1);<br />
2) Diskursmarker (§3.3.2):<br />
a) intratextuell;<br />
b) extratextuell;<br />
3) Konnektivpartikeln (§3.3.3);<br />
4) Fokuspartikeln (§3.3 und §3.3.2.1).<br />
17 Die Intensitätspartikeln stehen anders als die Fokuspartikeln direkt vor dem modifizierten Ausdruck,<br />
der kein Nomen sein kann. Auf diesen Unterschied gehe ich weiter nicht ein.