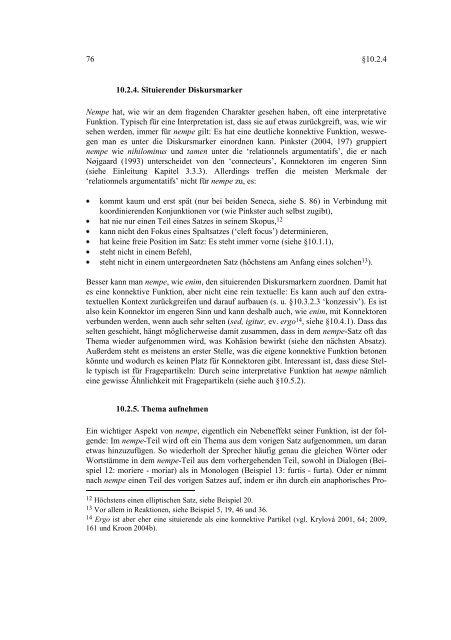Lateinische epistemische Partikeln - VU-DARE Home - Vrije ...
Lateinische epistemische Partikeln - VU-DARE Home - Vrije ...
Lateinische epistemische Partikeln - VU-DARE Home - Vrije ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
76<br />
§10.2.4<br />
10.2.4. Situierender Diskursmarker<br />
Nempe hat, wie wir an dem fragenden Charakter gesehen haben, oft eine interpretative<br />
Funktion. Typisch für eine Interpretation ist, dass sie auf etwas zurückgreift, was, wie wir<br />
sehen werden, immer für nempe gilt: Es hat eine deutliche konnektive Funktion, weswegen<br />
man es unter die Diskursmarker einordnen kann. Pinkster (2004, 197) gruppiert<br />
nempe wie nihilominus und tamen unter die „relationnels argumentatifs‟, die er nach<br />
Nøjgaard (1993) unterscheidet von den „connecteurs‟, Konnektoren im engeren Sinn<br />
(siehe Einleitung Kapitel 3.3.3). Allerdings treffen die meisten Merkmale der<br />
„relationnels argumentatifs‟ nicht für nempe zu, es:<br />
kommt kaum und erst spät (nur bei beiden Seneca, siehe S. 86) in Verbindung mit<br />
koordinierenden Konjunktionen vor (wie Pinkster auch selbst zugibt),<br />
hat nie nur einen Teil eines Satzes in seinem Skopus, 12<br />
kann nicht den Fokus eines Spaltsatzes („cleft focus‟) determinieren,<br />
hat keine freie Position im Satz: Es steht immer vorne (siehe §10.1.1),<br />
steht nicht in einem Befehl,<br />
steht nicht in einem untergeordneten Satz (höchstens am Anfang eines solchen 13 ).<br />
Besser kann man nempe, wie enim, den situierenden Diskursmarkern zuordnen. Damit hat<br />
es eine konnektive Funktion, aber nicht eine rein textuelle: Es kann auch auf den extratextuellen<br />
Kontext zurückgreifen und darauf aufbauen (s. u. §10.3.2.3 „konzessiv‟). Es ist<br />
also kein Konnektor im engeren Sinn und kann deshalb auch, wie enim, mit Konnektoren<br />
verbunden werden, wenn auch sehr selten (sed, igitur, ev. ergo 14 , siehe §10.4.1). Dass das<br />
selten geschieht, hängt möglicherweise damit zusammen, dass in dem nempe-Satz oft das<br />
Thema wieder aufgenommen wird, was Kohäsion bewirkt (siehe den nächsten Absatz).<br />
Außerdem steht es meistens an erster Stelle, was die eigene konnektive Funktion betonen<br />
könnte und wodurch es keinen Platz für Konnektoren gibt. Interessant ist, dass diese Stelle<br />
typisch ist für Fragepartikeln: Durch seine interpretative Funktion hat nempe nämlich<br />
eine gewisse Ähnlichkeit mit Fragepartikeln (siehe auch §10.5.2).<br />
10.2.5. Thema aufnehmen<br />
Ein wichtiger Aspekt von nempe, eigentlich ein Nebeneffekt seiner Funktion, ist der folgende:<br />
Im nempe-Teil wird oft ein Thema aus dem vorigen Satz aufgenommen, um daran<br />
etwas hinzuzufügen. So wiederholt der Sprecher häufig genau die gleichen Wörter oder<br />
Wortstämme in dem nempe-Teil aus dem vorhergehenden Teil, sowohl in Dialogen (Beispiel<br />
12: moriere - moriar) als in Monologen (Beispiel 13: furtis - furta). Oder er nimmt<br />
nach nempe einen Teil des vorigen Satzes auf, indem er ihn durch ein anaphorisches Pro-<br />
12 Höchstens einen elliptischen Satz, siehe Beispiel 20.<br />
13 Vor allem in Reaktionen, siehe Beispiel 5, 19, 46 und 36.<br />
14 Ergo ist aber eher eine situierende als eine konnektive Partikel (vgl. Krylová 2001, 64; 2009,<br />
161 und Kroon 2004b).