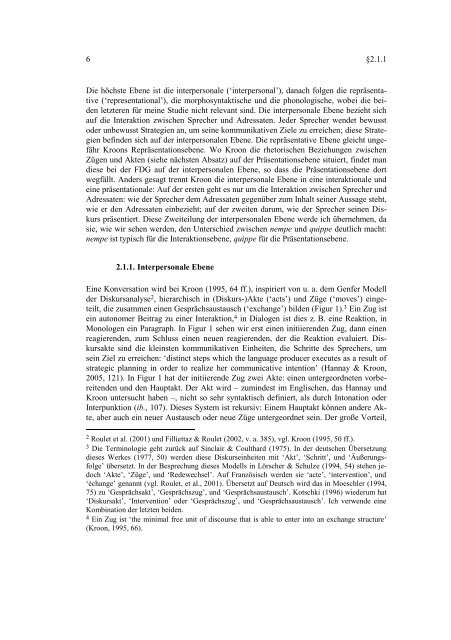Lateinische epistemische Partikeln - VU-DARE Home - Vrije ...
Lateinische epistemische Partikeln - VU-DARE Home - Vrije ...
Lateinische epistemische Partikeln - VU-DARE Home - Vrije ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
6<br />
§2.1.1<br />
Die höchste Ebene ist die interpersonale („interpersonal‟), danach folgen die repräsentative<br />
(„representational‟), die morphosyntaktische und die phonologische, wobei die beiden<br />
letzteren für meine Studie nicht relevant sind. Die interpersonale Ebene bezieht sich<br />
auf die Interaktion zwischen Sprecher und Adressaten. Jeder Sprecher wendet bewusst<br />
oder unbewusst Strategien an, um seine kommunikativen Ziele zu erreichen; diese Strategien<br />
befinden sich auf der interpersonalen Ebene. Die repräsentative Ebene gleicht ungefähr<br />
Kroons Repräsentationsebene. Wo Kroon die rhetorischen Beziehungen zwischen<br />
Zügen und Akten (siehe nächsten Absatz) auf der Präsentationsebene situiert, findet man<br />
diese bei der FDG auf der interpersonalen Ebene, so dass die Präsentationsebene dort<br />
wegfällt. Anders gesagt trennt Kroon die interpersonale Ebene in eine interaktionale und<br />
eine präsentationale: Auf der ersten geht es nur um die Interaktion zwischen Sprecher und<br />
Adressaten: wie der Sprecher dem Adressaten gegenüber zum Inhalt seiner Aussage steht,<br />
wie er den Adressaten einbezieht; auf der zweiten darum, wie der Sprecher seinen Diskurs<br />
präsentiert. Diese Zweiteilung der interpersonalen Ebene werde ich übernehmen, da<br />
sie, wie wir sehen werden, den Unterschied zwischen nempe und quippe deutlich macht:<br />
nempe ist typisch für die Interaktionsebene, quippe für die Präsentationsebene.<br />
2.1.1. Interpersonale Ebene<br />
Eine Konversation wird bei Kroon (1995, 64 ff.), inspiriert von u. a. dem Genfer Modell<br />
der Diskursanalyse 2 , hierarchisch in (Diskurs-)Akte („acts‟) und Züge („moves‟) eingeteilt,<br />
die zusammen einen Gesprächsaustausch („exchange‟) bilden (Figur 1). 3 Ein Zug ist<br />
ein autonomer Beitrag zu einer Interaktion, 4 in Dialogen ist dies z. B. eine Reaktion, in<br />
Monologen ein Paragraph. In Figur 1 sehen wir erst einen initiierenden Zug, dann einen<br />
reagierenden, zum Schluss einen neuen reagierenden, der die Reaktion evaluiert. Diskursakte<br />
sind die kleinsten kommunikativen Einheiten, die Schritte des Sprechers, um<br />
sein Ziel zu erreichen: „distinct steps which the language producer executes as a result of<br />
strategic planning in order to realize her communicative intention‟ (Hannay & Kroon,<br />
2005, 121). In Figur 1 hat der initiierende Zug zwei Akte: einen untergeordneten vorbereitenden<br />
und den Hauptakt. Der Akt wird – zumindest im Englischen, das Hannay und<br />
Kroon untersucht haben –, nicht so sehr syntaktisch definiert, als durch Intonation oder<br />
Interpunktion (ib., 107). Dieses System ist rekursiv: Einem Hauptakt können andere Akte,<br />
aber auch ein neuer Austausch oder neue Züge untergeordnet sein. Der große Vorteil,<br />
2 Roulet et al. (2001) und Filliettaz & Roulet (2002, v. a. 385), vgl. Kroon (1995, 50 ff.).<br />
3 Die Terminologie geht zurück auf Sinclair & Coulthard (1975). In der deutschen Übersetzung<br />
dieses Werkes (1977, 50) werden diese Diskurseinheiten mit „Akt‟, „Schritt‟, und „Äußerungsfolge‟<br />
übersetzt. In der Besprechung dieses Modells in Lörscher & Schulze (1994, 54) stehen jedoch<br />
„Akte‟, „Züge‟, und „Redewechsel‟. Auf Französisch werden sie „acte‟, „intervention‟, und<br />
„échange‟ genannt (vgl. Roulet, et al., 2001). Übersetzt auf Deutsch wird das in Moeschler (1994,<br />
75) zu „Gesprächsakt‟, „Gesprächszug‟, und „Gesprächsaustausch‟. Kotschki (1996) wiederum hat<br />
„Diskursakt‟, „Intervention‟ oder „Gesprächszug‟, und „Gesprächsaustausch‟. Ich verwende eine<br />
Kombination der letzten beiden.<br />
4 Ein Zug ist „the minimal free unit of discourse that is able to enter into an exchange structure‟<br />
(Kroon, 1995, 66).