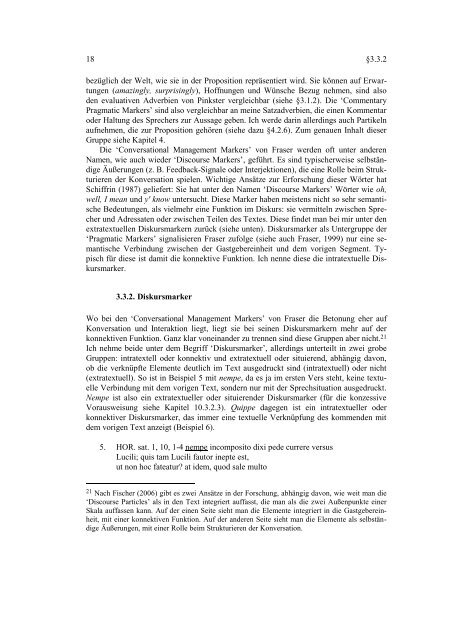Lateinische epistemische Partikeln - VU-DARE Home - Vrije ...
Lateinische epistemische Partikeln - VU-DARE Home - Vrije ...
Lateinische epistemische Partikeln - VU-DARE Home - Vrije ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
18<br />
§3.3.2<br />
bezüglich der Welt, wie sie in der Proposition repräsentiert wird. Sie können auf Erwartungen<br />
(amazingly, surprisingly), Hoffnungen und Wünsche Bezug nehmen, sind also<br />
den evaluativen Adverbien von Pinkster vergleichbar (siehe §3.1.2). Die „Commentary<br />
Pragmatic Markers‟ sind also vergleichbar an meine Satzadverbien, die einen Kommentar<br />
oder Haltung des Sprechers zur Aussage geben. Ich werde darin allerdings auch <strong>Partikeln</strong><br />
aufnehmen, die zur Proposition gehören (siehe dazu §4.2.6). Zum genauen Inhalt dieser<br />
Gruppe siehe Kapitel 4.<br />
Die „Conversational Management Markers‟ von Fraser werden oft unter anderen<br />
Namen, wie auch wieder „Discourse Markers‟, geführt. Es sind typischerweise selbständige<br />
Äußerungen (z. B. Feedback-Signale oder Interjektionen), die eine Rolle beim Strukturieren<br />
der Konversation spielen. Wichtige Ansätze zur Erforschung dieser Wörter hat<br />
Schiffrin (1987) geliefert: Sie hat unter den Namen „Discourse Markers‟ Wörter wie oh,<br />
well, I mean und y' know untersucht. Diese Marker haben meistens nicht so sehr semantische<br />
Bedeutungen, als vielmehr eine Funktion im Diskurs: sie vermitteln zwischen Sprecher<br />
und Adressaten oder zwischen Teilen des Textes. Diese findet man bei mir unter den<br />
extratextuellen Diskursmarkern zurück (siehe unten). Diskursmarker als Untergruppe der<br />
„Pragmatic Markers‟ signalisieren Fraser zufolge (siehe auch Fraser, 1999) nur eine semantische<br />
Verbindung zwischen der Gastgebereinheit und dem vorigen Segment. Typisch<br />
für diese ist damit die konnektive Funktion. Ich nenne diese die intratextuelle Diskursmarker.<br />
3.3.2. Diskursmarker<br />
Wo bei den „Conversational Management Markers‟ von Fraser die Betonung eher auf<br />
Konversation und Interaktion liegt, liegt sie bei seinen Diskursmarkern mehr auf der<br />
konnektiven Funktion. Ganz klar voneinander zu trennen sind diese Gruppen aber nicht. 21<br />
Ich nehme beide unter dem Begriff „Diskursmarker‟, allerdings unterteilt in zwei grobe<br />
Gruppen: intratextell oder konnektiv und extratextuell oder situierend, abhängig davon,<br />
ob die verknüpfte Elemente deutlich im Text ausgedruckt sind (intratextuell) oder nicht<br />
(extratextuell). So ist in Beispiel 5 mit nempe, da es ja im ersten Vers steht, keine textuelle<br />
Verbindung mit dem vorigen Text, sondern nur mit der Sprechsituation ausgedruckt.<br />
Nempe ist also ein extratextueller oder situierender Diskursmarker (für die konzessive<br />
Vorausweisung siehe Kapitel 10.3.2.3). Quippe dagegen ist ein intratextueller oder<br />
konnektiver Diskursmarker, das immer eine textuelle Verknüpfung des kommenden mit<br />
dem vorigen Text anzeigt (Beispiel 6).<br />
5. HOR. sat. 1, 10, 1-4 nempe incomposito dixi pede currere versus<br />
Lucili; quis tam Lucili fautor inepte est,<br />
ut non hoc fateatur? at idem, quod sale multo<br />
21 Nach Fischer (2006) gibt es zwei Ansätze in der Forschung, abhängig davon, wie weit man die<br />
„Discourse Particles‟ als in den Text integriert auffasst, die man als die zwei Außenpunkte einer<br />
Skala auffassen kann. Auf der einen Seite sieht man die Elemente integriert in die Gastgebereinheit,<br />
mit einer konnektiven Funktion. Auf der anderen Seite sieht man die Elemente als selbständige<br />
Äußerungen, mit einer Rolle beim Strukturieren der Konversation.