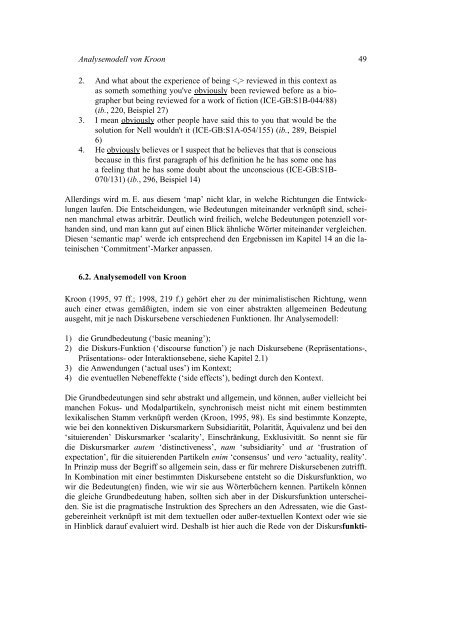Lateinische epistemische Partikeln - VU-DARE Home - Vrije ...
Lateinische epistemische Partikeln - VU-DARE Home - Vrije ...
Lateinische epistemische Partikeln - VU-DARE Home - Vrije ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Analysemodell von Kroon 49<br />
2. And what about the experience of being reviewed in this context as<br />
as someth something you've obviously been reviewed before as a biographer<br />
but being reviewed for a work of fiction (ICE-GB:S1B-044/88)<br />
(ib., 220, Beispiel 27)<br />
3. I mean obviously other people have said this to you that would be the<br />
solution for Nell wouldn't it (ICE-GB:S1A-054/155) (ib., 289, Beispiel<br />
6)<br />
4. He obviously believes or I suspect that he believes that that is conscious<br />
because in this first paragraph of his definition he he has some one has<br />
a feeling that he has some doubt about the unconscious (ICE-GB:S1B-<br />
070/131) (ib., 296, Beispiel 14)<br />
Allerdings wird m. E. aus diesem „map‟ nicht klar, in welche Richtungen die Entwicklungen<br />
laufen. Die Entscheidungen, wie Bedeutungen miteinander verknüpft sind, scheinen<br />
manchmal etwas arbiträr. Deutlich wird freilich, welche Bedeutungen potenziell vorhanden<br />
sind, und man kann gut auf einen Blick ähnliche Wörter miteinander vergleichen.<br />
Diesen „semantic map‟ werde ich entsprechend den Ergebnissen im Kapitel 14 an die lateinischen<br />
„Commitment‟-Marker anpassen.<br />
6.2. Analysemodell von Kroon<br />
Kroon (1995, 97 ff.; 1998, 219 f.) gehört eher zu der minimalistischen Richtung, wenn<br />
auch einer etwas gemäßigten, indem sie von einer abstrakten allgemeinen Bedeutung<br />
ausgeht, mit je nach Diskursebene verschiedenen Funktionen. Ihr Analysemodell:<br />
1) die Grundbedeutung („basic meaning‟);<br />
2) die Diskurs-Funktion („discourse function‟) je nach Diskursebene (Repräsentations-,<br />
Präsentations- oder Interaktionsebene, siehe Kapitel 2.1)<br />
3) die Anwendungen („actual uses‟) im Kontext;<br />
4) die eventuellen Nebeneffekte („side effects‟), bedingt durch den Kontext.<br />
Die Grundbedeutungen sind sehr abstrakt und allgemein, und können, außer vielleicht bei<br />
manchen Fokus- und Modalpartikeln, synchronisch meist nicht mit einem bestimmten<br />
lexikalischen Stamm verknüpft werden (Kroon, 1995, 98). Es sind bestimmte Konzepte,<br />
wie bei den konnektiven Diskursmarkern Subsidiarität, Polarität, Äquivalenz und bei den<br />
„situierenden‟ Diskursmarker „scalarity‟, Einschränkung, Exklusivität. So nennt sie für<br />
die Diskursmarker autem „distinctiveness‟, nam „subsidiarity‟ und at „frustration of<br />
expectation‟, für die situierenden <strong>Partikeln</strong> enim „consensus‟ und vero „actuality, reality‟.<br />
In Prinzip muss der Begriff so allgemein sein, dass er für mehrere Diskursebenen zutrifft.<br />
In Kombination mit einer bestimmten Diskursebene entsteht so die Diskursfunktion, wo<br />
wir die Bedeutung(en) finden, wie wir sie aus Wörterbüchern kennen. <strong>Partikeln</strong> können<br />
die gleiche Grundbedeutung haben, sollten sich aber in der Diskursfunktion unterscheiden.<br />
Sie ist die pragmatische Instruktion des Sprechers an den Adressaten, wie die Gastgebereinheit<br />
verknüpft ist mit dem textuellen oder außer-textuellen Kontext oder wie sie<br />
in Hinblick darauf evaluiert wird. Deshalb ist hier auch die Rede von der Diskursfunkti-