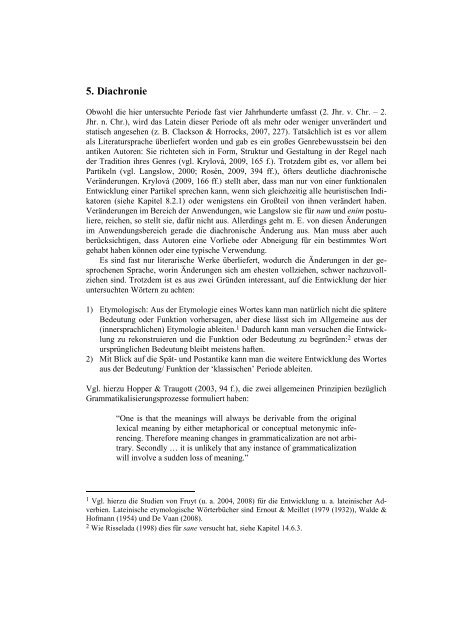Lateinische epistemische Partikeln - VU-DARE Home - Vrije ...
Lateinische epistemische Partikeln - VU-DARE Home - Vrije ...
Lateinische epistemische Partikeln - VU-DARE Home - Vrije ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
5. Diachronie<br />
Obwohl die hier untersuchte Periode fast vier Jahrhunderte umfasst (2. Jhr. v. Chr. – 2.<br />
Jhr. n. Chr.), wird das Latein dieser Periode oft als mehr oder weniger unverändert und<br />
statisch angesehen (z. B. Clackson & Horrocks, 2007, 227). Tatsächlich ist es vor allem<br />
als Literatursprache überliefert worden und gab es ein großes Genrebewusstsein bei den<br />
antiken Autoren: Sie richteten sich in Form, Struktur und Gestaltung in der Regel nach<br />
der Tradition ihres Genres (vgl. Krylová, 2009, 165 f.). Trotzdem gibt es, vor allem bei<br />
<strong>Partikeln</strong> (vgl. Langslow, 2000; Rosén, 2009, 394 ff.), öfters deutliche diachronische<br />
Veränderungen. Krylová (2009, 166 ff.) stellt aber, dass man nur von einer funktionalen<br />
Entwicklung einer Partikel sprechen kann, wenn sich gleichzeitig alle heuristischen Indikatoren<br />
(siehe Kapitel 8.2.1) oder wenigstens ein Großteil von ihnen verändert haben.<br />
Veränderungen im Bereich der Anwendungen, wie Langslow sie für nam und enim postuliere,<br />
reichen, so stellt sie, dafür nicht aus. Allerdings geht m. E. von diesen Änderungen<br />
im Anwendungsbereich gerade die diachronische Änderung aus. Man muss aber auch<br />
berücksichtigen, dass Autoren eine Vorliebe oder Abneigung für ein bestimmtes Wort<br />
gehabt haben können oder eine typische Verwendung.<br />
Es sind fast nur literarische Werke überliefert, wodurch die Änderungen in der gesprochenen<br />
Sprache, worin Änderungen sich am ehesten vollziehen, schwer nachzuvollziehen<br />
sind. Trotzdem ist es aus zwei Gründen interessant, auf die Entwicklung der hier<br />
untersuchten Wörtern zu achten:<br />
1) Etymologisch: Aus der Etymologie eines Wortes kann man natürlich nicht die spätere<br />
Bedeutung oder Funktion vorhersagen, aber diese lässt sich im Allgemeine aus der<br />
(innersprachlichen) Etymologie ableiten. 1 Dadurch kann man versuchen die Entwicklung<br />
zu rekonstruieren und die Funktion oder Bedeutung zu begründen: 2 etwas der<br />
ursprünglichen Bedeutung bleibt meistens haften.<br />
2) Mit Blick auf die Spät- und Postantike kann man die weitere Entwicklung des Wortes<br />
aus der Bedeutung/ Funktion der „klassischen‟ Periode ableiten.<br />
Vgl. hierzu Hopper & Traugott (2003, 94 f.), die zwei allgemeinen Prinzipien bezüglich<br />
Grammatikalisierungsprozesse formuliert haben:<br />
“One is that the meanings will always be derivable from the original<br />
lexical meaning by either metaphorical or conceptual metonymic inferencing.<br />
Therefore meaning changes in grammaticalization are not arbitrary.<br />
Secondly … it is unlikely that any instance of grammaticalization<br />
will involve a sudden loss of meaning.”<br />
1 Vgl. hierzu die Studien von Fruyt (u. a. 2004, 2008) für die Entwicklung u. a. lateinischer Adverbien.<br />
<strong>Lateinische</strong> etymologische Wörterbücher sind Ernout & Meillet (1979 (1932)), Walde &<br />
Hofmann (1954) und De Vaan (2008).<br />
2 Wie Risselada (1998) dies für sane versucht hat, siehe Kapitel 14.6.3.