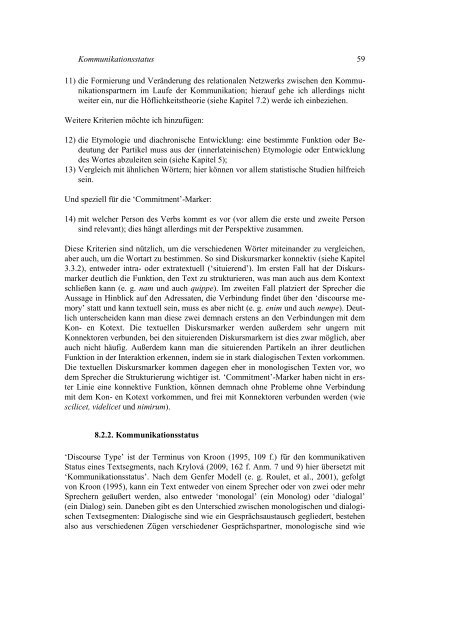Lateinische epistemische Partikeln - VU-DARE Home - Vrije ...
Lateinische epistemische Partikeln - VU-DARE Home - Vrije ...
Lateinische epistemische Partikeln - VU-DARE Home - Vrije ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kommunikationsstatus 59<br />
11) die Formierung und Veränderung des relationalen Netzwerks zwischen den Kommunikationspartnern<br />
im Laufe der Kommunikation; hierauf gehe ich allerdings nicht<br />
weiter ein, nur die Höflichkeitstheorie (siehe Kapitel 7.2) werde ich einbeziehen.<br />
Weitere Kriterien möchte ich hinzufügen:<br />
12) die Etymologie und diachronische Entwicklung: eine bestimmte Funktion oder Bedeutung<br />
der Partikel muss aus der (innerlateinischen) Etymologie oder Entwicklung<br />
des Wortes abzuleiten sein (siehe Kapitel 5);<br />
13) Vergleich mit ähnlichen Wörtern; hier können vor allem statistische Studien hilfreich<br />
sein.<br />
Und speziell für die „Commitment‟-Marker:<br />
14) mit welcher Person des Verbs kommt es vor (vor allem die erste und zweite Person<br />
sind relevant); dies hängt allerdings mit der Perspektive zusammen.<br />
Diese Kriterien sind nützlich, um die verschiedenen Wörter miteinander zu vergleichen,<br />
aber auch, um die Wortart zu bestimmen. So sind Diskursmarker konnektiv (siehe Kapitel<br />
3.3.2), entweder intra- oder extratextuell („situierend‟). Im ersten Fall hat der Diskursmarker<br />
deutlich die Funktion, den Text zu strukturieren, was man auch aus dem Kontext<br />
schließen kann (e. g. nam und auch quippe). Im zweiten Fall platziert der Sprecher die<br />
Aussage in Hinblick auf den Adressaten, die Verbindung findet über den „discourse memory‟<br />
statt und kann textuell sein, muss es aber nicht (e. g. enim und auch nempe). Deutlich<br />
unterscheiden kann man diese zwei demnach erstens an den Verbindungen mit dem<br />
Kon- en Kotext. Die textuellen Diskursmarker werden außerdem sehr ungern mit<br />
Konnektoren verbunden, bei den situierenden Diskursmarkern ist dies zwar möglich, aber<br />
auch nicht häufig. Außerdem kann man die situierenden <strong>Partikeln</strong> an ihrer deutlichen<br />
Funktion in der Interaktion erkennen, indem sie in stark dialogischen Texten vorkommen.<br />
Die textuellen Diskursmarker kommen dagegen eher in monologischen Texten vor, wo<br />
dem Sprecher die Strukturierung wichtiger ist. „Commitment‟-Marker haben nicht in erster<br />
Linie eine konnektive Funktion, können demnach ohne Probleme ohne Verbindung<br />
mit dem Kon- en Kotext vorkommen, und frei mit Konnektoren verbunden werden (wie<br />
scilicet, videlicet und nimirum).<br />
8.2.2. Kommunikationsstatus<br />
„Discourse Type‟ ist der Terminus von Kroon (1995, 109 f.) für den kommunikativen<br />
Status eines Textsegments, nach Krylová (2009, 162 f. Anm. 7 und 9) hier übersetzt mit<br />
„Kommunikationsstatus‟. Nach dem Genfer Modell (e. g. Roulet, et al., 2001), gefolgt<br />
von Kroon (1995), kann ein Text entweder von einem Sprecher oder von zwei oder mehr<br />
Sprechern geäußert werden, also entweder „monologal‟ (ein Monolog) oder „dialogal‟<br />
(ein Dialog) sein. Daneben gibt es den Unterschied zwischen monologischen und dialogischen<br />
Textsegmenten: Dialogische sind wie ein Gesprächsaustausch gegliedert, bestehen<br />
also aus verschiedenen Zügen verschiedener Gesprächspartner, monologische sind wie