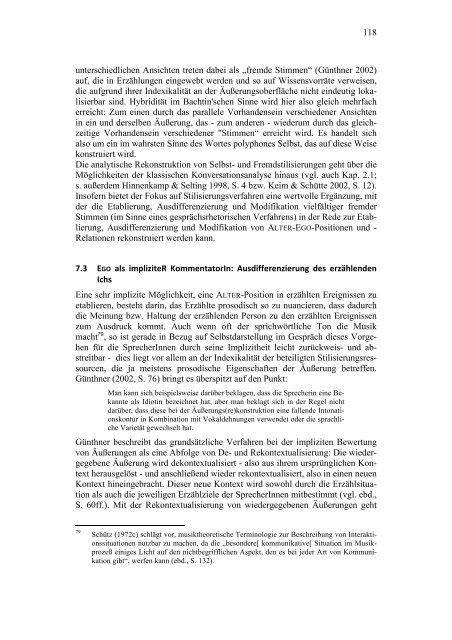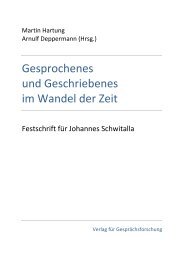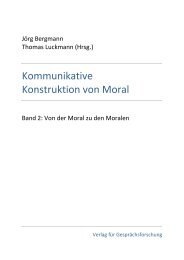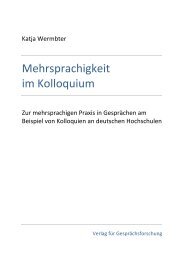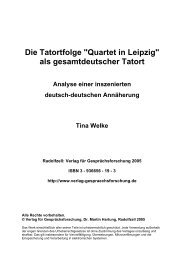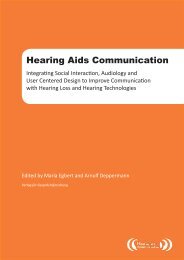Sprechen über sich selbst als kontrastives Verfahren - Verlag für ...
Sprechen über sich selbst als kontrastives Verfahren - Verlag für ...
Sprechen über sich selbst als kontrastives Verfahren - Verlag für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
118unterschiedlichen An<strong>sich</strong>ten treten dabei <strong>als</strong> „fremde Stimmen“ (Günthner 2002)auf, die in Erzählungen eingewebt werden und so auf Wissensvorräte verweisen,die aufgrund ihrer Indexikalität an der Äußerungsoberfläche nicht eindeutig lokalisierbarsind. Hybridität im Bachtin'schen Sinne wird hier <strong>als</strong>o gleich mehrfacherreicht: Zum einen durch das parallele Vorhandensein verschiedener An<strong>sich</strong>tenin ein und derselben Äußerung, das - zum anderen - wiederum durch das gleichzeitigeVorhandensein verschiedener "Stimmen“ erreicht wird. Es handelt <strong>sich</strong><strong>als</strong>o um ein im wahrsten Sinne des Wortes polyphones Selbst, das auf diese Weisekonstruiert wird.Die analytische Rekonstruktion von Selbst- und Fremdstilisierungen geht <strong>über</strong> dieMöglichkeiten der klassischen Konversationsanalyse hinaus (vgl. auch Kap. 2.1;s. außerdem Hinnenkamp & Selting 1998, S. 4 bzw. Keim & Schütte 2002, S. 12).Insofern bietet der Fokus auf Stilisierungsverfahren eine wertvolle Ergänzung, mitder die Etablierung, Ausdifferenzierung und Modifikation vielfältiger fremderStimmen (im Sinne eines gesprächsrhetorischen <strong>Verfahren</strong>s) in der Rede zur Etablierung,Ausdifferenzierung und Modifikation von ALTER-EGO-Positionen und -Relationen rekonstruiert werden kann.7.3 EGO <strong>als</strong> impliziteR KommentatorIn: Ausdifferenzierung des erzählenden Ichs Eine sehr implizite Möglichkeit, eine ALTER-Position in erzählten Ereignissen zuetablieren, besteht darin, das Erzählte prosodisch so zu nuancieren, dass dadurchdie Meinung bzw. Haltung der erzählenden Person zu den erzählten Ereignissenzum Ausdruck kommt. Auch wenn oft der sprichwörtliche Ton die Musikmacht 79 , so ist gerade in Bezug auf Selbstdarstellung im Gespräch dieses Vorgehen<strong>für</strong> die SprecherInnen durch seine Implizitheit leicht zurückweis- und abstreitbar- dies liegt vor allem an der Indexikalität der beteiligten Stilisierungsressourcen,die ja meistens prosodische Eigenschaften der Äußerung betreffen.Günthner (2002, S. 76) bringt es <strong>über</strong>spitzt auf den Punkt:Man kann <strong>sich</strong> beispielsweise dar<strong>über</strong> beklagen, dass die Sprecherin eine Bekannte<strong>als</strong> Idiotin bezeichnet hat, aber man beklagt <strong>sich</strong> in der Regel nichtdar<strong>über</strong>, dass diese bei der Äußerungs(re)konstruktion eine fallende Intonationskonturin Kombination mit Vokaldehnungen verwendet oder die sprachlicheVarietät gewechselt hat.Günthner beschreibt das grundsätzliche <strong>Verfahren</strong> bei der impliziten Bewertungvon Äußerungen <strong>als</strong> eine Abfolge von De- und Rekontextualisierung: Die wiedergegebeneÄußerung wird dekontextualisiert - <strong>als</strong>o aus ihrem ursprünglichen Kontextherausgelöst - und anschließend wieder rekontextualisiert, <strong>als</strong>o in einen neuenKontext hineingebracht. Dieser neue Kontext wird sowohl durch die Erzählsituation<strong>als</strong> auch die jeweiligen Erzählziele der SprecherInnen mitbestimmt (vgl. ebd.,S. 60ff.). Mit der Rekontextualisierung von wiedergegebenen Äußerungen geht79Schütz (1972c) schlägt vor, musiktheoretische Terminologie zur Beschreibung von Interaktionssituationennutzbar zu machen, da die „besondere[ kommunikative[ Situation im Musikprozeßeiniges Licht auf den nichtbegrifflichen Aspekt, den es bei jeder Art von Kommunikationgibt“, werfen kann (ebd., S. 132).