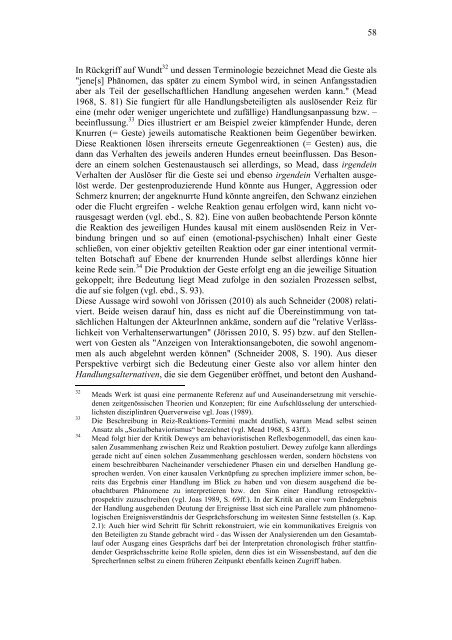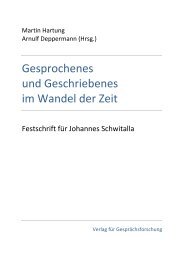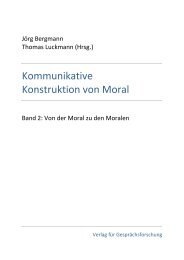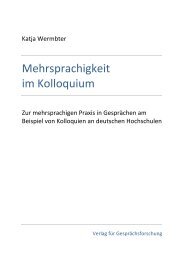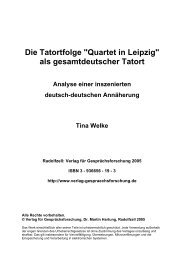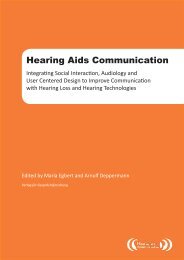Sprechen über sich selbst als kontrastives Verfahren - Verlag für ...
Sprechen über sich selbst als kontrastives Verfahren - Verlag für ...
Sprechen über sich selbst als kontrastives Verfahren - Verlag für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
58In Rückgriff auf Wundt 32 und dessen Terminologie bezeichnet Mead die Geste <strong>als</strong>"jene[s] Phänomen, das später zu einem Symbol wird, in seinen Anfangsstadienaber <strong>als</strong> Teil der gesellschaftlichen Handlung angesehen werden kann." (Mead1968, S. 81) Sie fungiert <strong>für</strong> alle Handlungsbeteiligten <strong>als</strong> auslösender Reiz <strong>für</strong>eine (mehr oder weniger ungerichtete und zufällige) Handlungsanpassung bzw. –beeinflussung. 33 Dies illustriert er am Beispiel zweier kämpfender Hunde, derenKnurren (= Geste) jeweils automatische Reaktionen beim Gegen<strong>über</strong> bewirken.Diese Reaktionen lösen ihrerseits erneute Gegenreaktionen (= Gesten) aus, diedann das Verhalten des jeweils anderen Hundes erneut beeinflussen. Das Besonderean einem solchen Gestenaustausch sei allerdings, so Mead, dass irgendeinVerhalten der Auslöser <strong>für</strong> die Geste sei und ebenso irgendein Verhalten ausgelöstwerde. Der gestenproduzierende Hund könnte aus Hunger, Aggression oderSchmerz knurren; der angeknurrte Hund könnte angreifen, den Schwanz einziehenoder die Flucht ergreifen - welche Reaktion genau erfolgen wird, kann nicht vorausgesagtwerden (vgl. ebd., S. 82). Eine von außen beobachtende Person könntedie Reaktion des jeweiligen Hundes kausal mit einem auslösenden Reiz in Verbindungbringen und so auf einen (emotional-psychischen) Inhalt einer Gesteschließen, von einer objektiv geteilten Reaktion oder gar einer intentional vermitteltenBotschaft auf Ebene der knurrenden Hunde <strong>selbst</strong> allerdings könne hierkeine Rede sein. 34 Die Produktion der Geste erfolgt eng an die jeweilige Situationgekoppelt; ihre Bedeutung liegt Mead zufolge in den sozialen Prozessen <strong>selbst</strong>,die auf sie folgen (vgl. ebd., S. 93).Diese Aussage wird sowohl von Jörissen (2010) <strong>als</strong> auch Schneider (2008) relativiert.Beide weisen darauf hin, dass es nicht auf die Übereinstimmung von tatsächlichenHaltungen der AkteurInnen ankäme, sondern auf die "relative Verlässlichkeitvon Verhaltenserwartungen" (Jörissen 2010, S. 95) bzw. auf den Stellenwertvon Gesten <strong>als</strong> "Anzeigen von Interaktionsangeboten, die sowohl angenommen<strong>als</strong> auch abgelehnt werden können" (Schneider 2008, S. 190). Aus dieserPerspektive verbirgt <strong>sich</strong> die Bedeutung einer Geste <strong>als</strong>o vor allem hinter denHandlungsalternativen, die sie dem Gegen<strong>über</strong> eröffnet, und betont den Aushand-323334Meads Werk ist quasi eine permanente Referenz auf und Auseinandersetzung mit verschiedenenzeitgenössischen Theorien und Konzepten; <strong>für</strong> eine Aufschlüsselung der unterschiedlichstendisziplinären Querverweise vgl. Joas (1989).Die Beschreibung in Reiz-Reaktions-Termini macht deutlich, warum Mead <strong>selbst</strong> seinenAnsatz <strong>als</strong> „Sozialbehaviorismus“ bezeichnet (vgl. Mead 1968, S 43ff.).Mead folgt hier der Kritik Deweys am behavioristischen Reflexbogenmodell, das einen kausalenZusammenhang zwischen Reiz und Reaktion postuliert. Dewey zufolge kann allerdingsgerade nicht auf einen solchen Zusammenhang geschlossen werden, sondern höchstens voneinem beschreibbaren Nacheinander verschiedener Phasen ein und derselben Handlung gesprochenwerden. Von einer kausalen Verknüpfung zu sprechen impliziere immer schon, bereitsdas Ergebnis einer Handlung im Blick zu haben und von diesem ausgehend die beobachtbarenPhänomene zu interpretieren bzw. den Sinn einer Handlung retrospektivprospektivzuzuschreiben (vgl. Joas 1989, S. 69ff.). In der Kritik an einer vom Endergebnisder Handlung ausgehenden Deutung der Ereignisse lässt <strong>sich</strong> eine Parallele zum phänomenologischenEreignisverständnis der Gesprächsforschung im weitesten Sinne feststellen (s. Kap.2.1): Auch hier wird Schritt <strong>für</strong> Schritt rekonstruiert, wie ein kommunikatives Ereignis vonden Beteiligten zu Stande gebracht wird - das Wissen der Analysierenden um den Gesamtablaufoder Ausgang eines Gesprächs darf bei der Interpretation chronologisch früher stattfindenderGesprächsschritte keine Rolle spielen, denn dies ist ein Wissensbestand, auf den dieSprecherInnen <strong>selbst</strong> zu einem früheren Zeitpunkt ebenfalls keinen Zugriff haben.