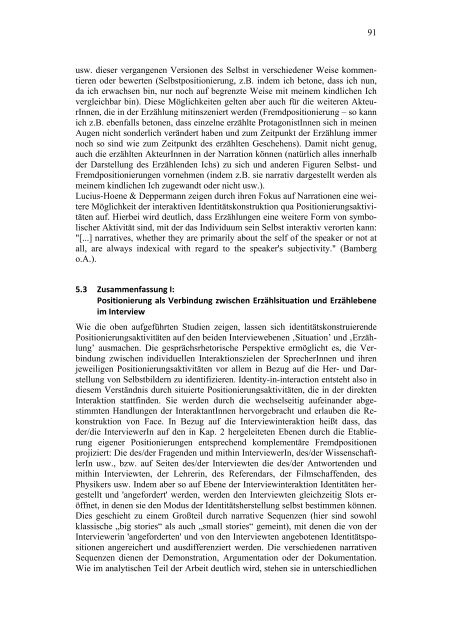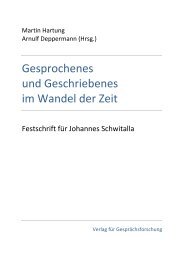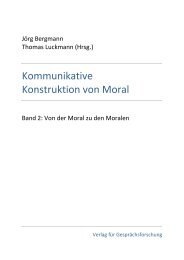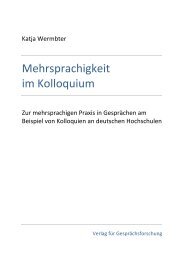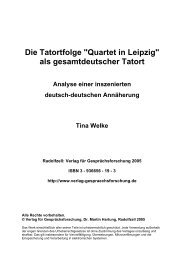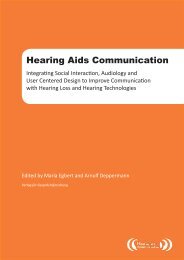Sprechen über sich selbst als kontrastives Verfahren - Verlag für ...
Sprechen über sich selbst als kontrastives Verfahren - Verlag für ...
Sprechen über sich selbst als kontrastives Verfahren - Verlag für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
91usw. dieser vergangenen Versionen des Selbst in verschiedener Weise kommentierenoder bewerten (Selbstpositionierung, z.B. indem ich betone, dass ich nun,da ich erwachsen bin, nur noch auf begrenzte Weise mit meinem kindlichen Ichvergleichbar bin). Diese Möglichkeiten gelten aber auch <strong>für</strong> die weiteren AkteurInnen,die in der Erzählung mitinszeniert werden (Fremdpositionierung – so kannich z.B. ebenfalls betonen, dass einzelne erzählte ProtagonistInnen <strong>sich</strong> in meinenAugen nicht sonderlich verändert haben und zum Zeitpunkt der Erzählung immernoch so sind wie zum Zeitpunkt des erzählten Geschehens). Damit nicht genug,auch die erzählten AkteurInnen in der Narration können (natürlich alles innerhalbder Darstellung des Erzählenden Ichs) zu <strong>sich</strong> und anderen Figuren Selbst- undFremdpositionierungen vornehmen (indem z.B. sie narrativ dargestellt werden <strong>als</strong>meinem kindlichen Ich zugewandt oder nicht usw.).Lucius-Hoene & Deppermann zeigen durch ihren Fokus auf Narrationen eine weitereMöglichkeit der interaktiven Identitätskonstruktion qua Positionierungsaktivitätenauf. Hierbei wird deutlich, dass Erzählungen eine weitere Form von symbolischerAktivität sind, mit der das Individuum sein Selbst interaktiv verorten kann:"[...] narratives, whether they are primarily about the self of the speaker or not atall, are always indexical with regard to the speaker's subjectivity." (Bambergo.A.).5.3 Zusammenfassung I: Positionierung <strong>als</strong> Verbindung zwischen Erzählsituation und Erzählebene im Interview Wie die oben aufgeführten Studien zeigen, lassen <strong>sich</strong> identitätskonstruierendePositionierungsaktivitäten auf den beiden Interviewebenen ‚Situation’ und ‚Erzählung’ausmachen. Die gesprächsrhetorische Perspektive ermöglicht es, die Verbindungzwischen individuellen Interaktionszielen der SprecherInnen und ihrenjeweiligen Positionierungsaktivitäten vor allem in Bezug auf die Her- und Darstellungvon Selbstbildern zu identifizieren. Identity-in-interaction entsteht <strong>als</strong>o indiesem Verständnis durch situierte Positionierungsaktivitäten, die in der direktenInteraktion stattfinden. Sie werden durch die wechselseitig aufeinander abgestimmtenHandlungen der InteraktantInnen hervorgebracht und erlauben die Rekonstruktionvon Face. In Bezug auf die Interviewinteraktion heißt dass, dasder/die InterviewerIn auf den in Kap. 2 hergeleiteten Ebenen durch die Etablierungeigener Positionierungen entsprechend komplementäre Fremdpositionenprojiziert: Die des/der Fragenden und mithin InterviewerIn, des/der WissenschaftlerInusw., bzw. auf Seiten des/der Interviewten die des/der Antwortenden undmithin Interviewten, der Lehrerin, des Referendars, der Filmschaffenden, desPhysikers usw. Indem aber so auf Ebene der Interviewinteraktion Identitäten hergestelltund 'angefordert' werden, werden den Interviewten gleichzeitig Slots eröffnet,in denen sie den Modus der Identitätsherstellung <strong>selbst</strong> bestimmen können.Dies geschieht zu einem Großteil durch narrative Sequenzen (hier sind sowohlklassische „big stories“ <strong>als</strong> auch „small stories“ gemeint), mit denen die von derInterviewerin 'angeforderten' und von den Interviewten angebotenen Identitätspositionenangereichert und ausdifferenziert werden. Die verschiedenen narrativenSequenzen dienen der Demonstration, Argumentation oder der Dokumentation.Wie im analytischen Teil der Arbeit deutlich wird, stehen sie in unterschiedlichen