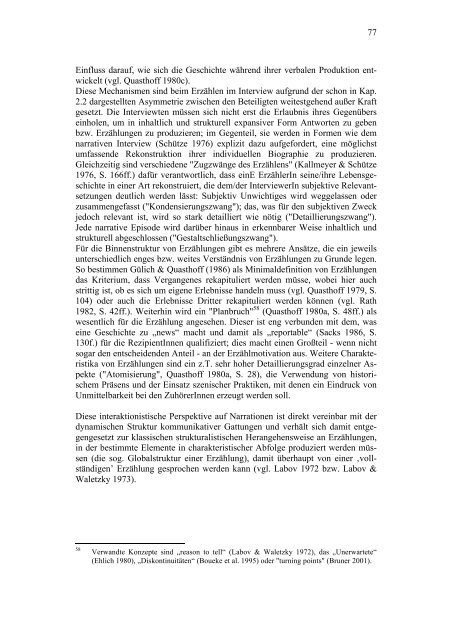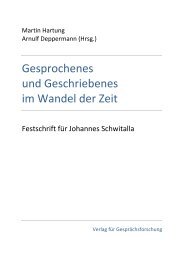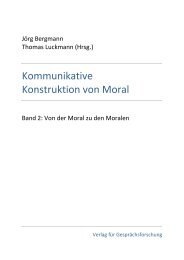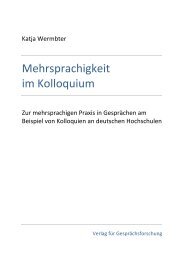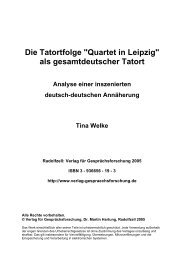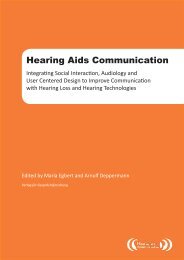Sprechen über sich selbst als kontrastives Verfahren - Verlag für ...
Sprechen über sich selbst als kontrastives Verfahren - Verlag für ...
Sprechen über sich selbst als kontrastives Verfahren - Verlag für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
77Einfluss darauf, wie <strong>sich</strong> die Geschichte während ihrer verbalen Produktion entwickelt(vgl. Quasthoff 1980c).Diese Mechanismen sind beim Erzählen im Interview aufgrund der schon in Kap.2.2 dargestellten Asymmetrie zwischen den Beteiligten weitestgehend außer Kraftgesetzt. Die Interviewten müssen <strong>sich</strong> nicht erst die Erlaubnis ihres Gegen<strong>über</strong>seinholen, um in inhaltlich und strukturell expansiver Form Antworten zu gebenbzw. Erzählungen zu produzieren; im Gegenteil, sie werden in Formen wie demnarrativen Interview (Schütze 1976) explizit dazu aufgefordert, eine möglichstumfassende Rekonstruktion ihrer individuellen Biographie zu produzieren.Gleichzeitig sind verschiedene "Zugzwänge des Erzählens" (Kallmeyer & Schütze1976, S. 166ff.) da<strong>für</strong> verantwortlich, dass einE ErzählerIn seine/ihre Lebensgeschichtein einer Art rekonstruiert, die dem/der InterviewerIn subjektive Relevantsetzungendeutlich werden lässt: Subjektiv Unwichtiges wird weggelassen oderzusammengefasst ("Kondensierungszwang"); das, was <strong>für</strong> den subjektiven Zweckjedoch relevant ist, wird so stark detailliert wie nötig ("Detaillierungszwang").Jede narrative Episode wird dar<strong>über</strong> hinaus in erkennbarer Weise inhaltlich undstrukturell abgeschlossen ("Gestaltschließungszwang").Für die Binnenstruktur von Erzählungen gibt es mehrere Ansätze, die ein jeweilsunterschiedlich enges bzw. weites Verständnis von Erzählungen zu Grunde legen.So bestimmen Gülich & Quasthoff (1986) <strong>als</strong> Minimaldefinition von Erzählungendas Kriterium, dass Vergangenes rekapituliert werden müsse, wobei hier auchstrittig ist, ob es <strong>sich</strong> um eigene Erlebnisse handeln muss (vgl. Quasthoff 1979, S.104) oder auch die Erlebnisse Dritter rekapituliert werden können (vgl. Rath1982, S. 42ff.). Weiterhin wird ein "Planbruch" 58 (Quasthoff 1980a, S. 48ff.) <strong>als</strong>wesentlich <strong>für</strong> die Erzählung angesehen. Dieser ist eng verbunden mit dem, waseine Geschichte zu „news“ macht und damit <strong>als</strong> „reportable“ (Sacks 1986, S.130f.) <strong>für</strong> die RezipientInnen qualifiziert; dies macht einen Großteil - wenn nichtsogar den entscheidenden Anteil - an der Erzählmotivation aus. Weitere Charakteristikavon Erzählungen sind ein z.T. sehr hoher Detaillierungsgrad einzelner Aspekte("Atomisierung", Quasthoff 1980a, S. 28), die Verwendung von historischemPräsens und der Einsatz szenischer Praktiken, mit denen ein Eindruck vonUnmittelbarkeit bei den ZuhörerInnen erzeugt werden soll.Diese interaktionistische Perspektive auf Narrationen ist direkt vereinbar mit derdynamischen Struktur kommunikativer Gattungen und verhält <strong>sich</strong> damit entgegengesetztzur klassischen strukturalistischen Herangehensweise an Erzählungen,in der bestimmte Elemente in charakteristischer Abfolge produziert werden müssen(die sog. Glob<strong>als</strong>truktur einer Erzählung), damit <strong>über</strong>haupt von einer ‚vollständigen’Erzählung gesprochen werden kann (vgl. Labov 1972 bzw. Labov &Waletzky 1973).58Verwandte Konzepte sind „reason to tell“ (Labov & Waletzky 1972), das „Unerwartete“(Ehlich 1980), „Diskontinuitäten“ (Boueke et al. 1995) oder "turning points" (Bruner 2001).