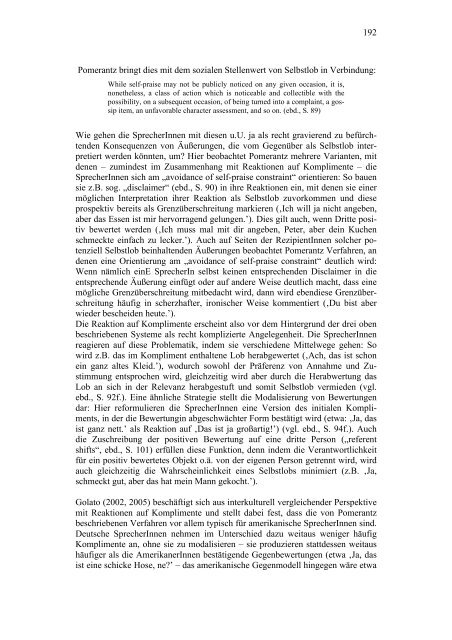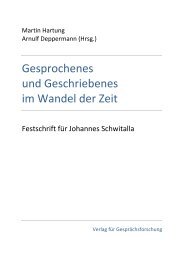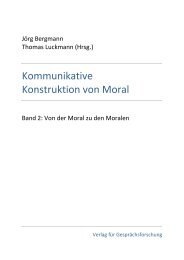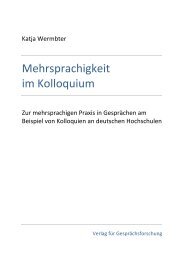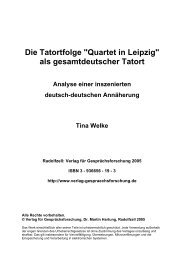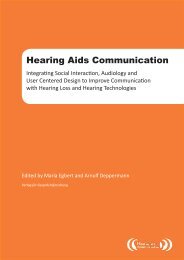Sprechen über sich selbst als kontrastives Verfahren - Verlag für ...
Sprechen über sich selbst als kontrastives Verfahren - Verlag für ...
Sprechen über sich selbst als kontrastives Verfahren - Verlag für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
192Pomerantz bringt dies mit dem sozialen Stellenwert von Selbstlob in Verbindung:While self-praise may not be publicly noticed on any given occasion, it is,nonetheless, a class of action which is noticeable and collectible with thepossibility, on a subsequent occasion, of being turned into a complaint, a gossipitem, an unfavorable character assessment, and so on. (ebd., S. 89)Wie gehen die SprecherInnen mit diesen u.U. ja <strong>als</strong> recht gravierend zu be<strong>für</strong>chtendenKonsequenzen von Äußerungen, die vom Gegen<strong>über</strong> <strong>als</strong> Selbstlob interpretiertwerden könnten, um? Hier beobachtet Pomerantz mehrere Varianten, mitdenen – zumindest im Zusammenhang mit Reaktionen auf Komplimente – dieSprecherInnen <strong>sich</strong> am „avoidance of self-praise constraint“ orientieren: So bauensie z.B. sog. „disclaimer“ (ebd., S. 90) in ihre Reaktionen ein, mit denen sie einermöglichen Interpretation ihrer Reaktion <strong>als</strong> Selbstlob zuvorkommen und dieseprospektiv bereits <strong>als</strong> Grenz<strong>über</strong>schreitung markieren (‚Ich will ja nicht angeben,aber das Essen ist mir hervorragend gelungen.’). Dies gilt auch, wenn Dritte positivbewertet werden (‚Ich muss mal mit dir angeben, Peter, aber dein Kuchenschmeckte einfach zu lecker.’). Auch auf Seiten der RezipientInnen solcher potenziellSelbstlob beinhaltenden Äußerungen beobachtet Pomerantz <strong>Verfahren</strong>, andenen eine Orientierung am „avoidance of self-praise constraint“ deutlich wird:Wenn nämlich einE SprecherIn <strong>selbst</strong> keinen entsprechenden Disclaimer in dieentsprechende Äußerung einfügt oder auf andere Weise deutlich macht, dass einemögliche Grenz<strong>über</strong>schreitung mitbedacht wird, dann wird ebendiese Grenz<strong>über</strong>schreitunghäufig in scherzhafter, ironischer Weise kommentiert (‚Du bist aberwieder bescheiden heute.’).Die Reaktion auf Komplimente erscheint <strong>als</strong>o vor dem Hintergrund der drei obenbeschriebenen Systeme <strong>als</strong> recht komplizierte Angelegenheit. Die SprecherInnenreagieren auf diese Problematik, indem sie verschiedene Mittelwege gehen: Sowird z.B. das im Kompliment enthaltene Lob herabgewertet (‚Ach, das ist schonein ganz altes Kleid.’), wodurch sowohl der Präferenz von Annahme und Zustimmungentsprochen wird, gleichzeitig wird aber durch die Herabwertung dasLob an <strong>sich</strong> in der Relevanz herabgestuft und somit Selbstlob vermieden (vgl.ebd., S. 92f.). Eine ähnliche Strategie stellt die Modalisierung von Bewertungendar: Hier reformulieren die SprecherInnen eine Version des initialen Kompliments,in der die Bewertungin abgeschwächter Form bestätigt wird (etwa: ‚Ja, dasist ganz nett.’ <strong>als</strong> Reaktion auf ‚Das ist ja großartig!’) (vgl. ebd., S. 94f.). Auchdie Zuschreibung der positiven Bewertung auf eine dritte Person („referentshifts“, ebd., S. 101) erfüllen diese Funktion, denn indem die Verantwortlichkeit<strong>für</strong> ein positiv bewertetes Objekt o.ä. von der eigenen Person getrennt wird, wirdauch gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit eines Selbstlobs minimiert (z.B. ‚Ja,schmeckt gut, aber das hat mein Mann gekocht.’).Golato (2002, 2005) beschäftigt <strong>sich</strong> aus interkulturell vergleichender Perspektivemit Reaktionen auf Komplimente und stellt dabei fest, dass die von Pomerantzbeschriebenen <strong>Verfahren</strong> vor allem typisch <strong>für</strong> amerikanische SprecherInnen sind.Deutsche SprecherInnen nehmen im Unterschied dazu weitaus weniger häufigKomplimente an, ohne sie zu modalisieren – sie produzieren stattdessen weitaushäufiger <strong>als</strong> die AmerikanerInnen bestätigende Gegenbewertungen (etwa ‚Ja, dasist eine schicke Hose, ne?’ – das amerikanische Gegenmodell hingegen wäre etwa