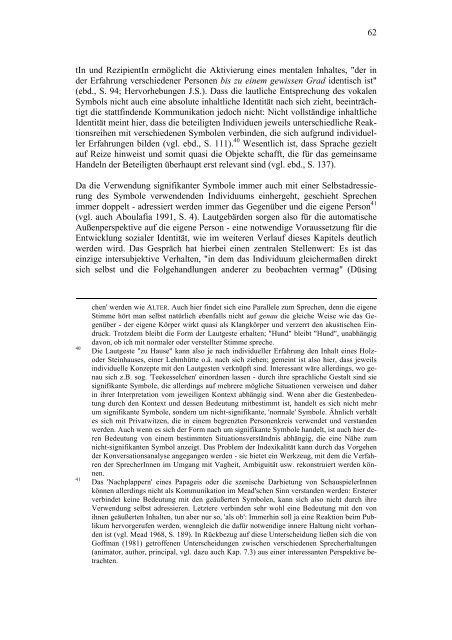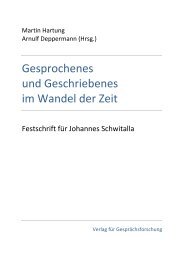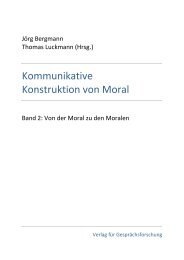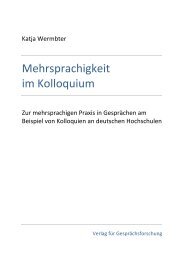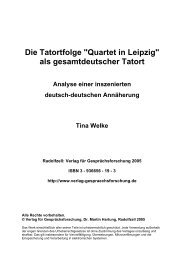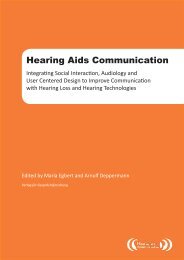Sprechen über sich selbst als kontrastives Verfahren - Verlag für ...
Sprechen über sich selbst als kontrastives Verfahren - Verlag für ...
Sprechen über sich selbst als kontrastives Verfahren - Verlag für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
62tIn und RezipientIn ermöglicht die Aktivierung eines mentalen Inhaltes, "der inder Erfahrung verschiedener Personen bis zu einem gewissen Grad identisch ist"(ebd., S. 94; Hervorhebungen J.S.). Dass die lautliche Entsprechung des vokalenSymbols nicht auch eine absolute inhaltliche Identität nach <strong>sich</strong> zieht, beeinträchtigtdie stattfindende Kommunikation jedoch nicht: Nicht vollständige inhaltlicheIdentität meint hier, dass die beteiligten Individuen jeweils unterschiedliche Reaktionsreihenmit verschiedenen Symbolen verbinden, die <strong>sich</strong> aufgrund individuellerErfahrungen bilden (vgl. ebd., S. 111). 40 Wesentlich ist, dass Sprache gezieltauf Reize hinweist und somit quasi die Objekte schafft, die <strong>für</strong> das gemeinsameHandeln der Beteiligten <strong>über</strong>haupt erst relevant sind (vgl. ebd., S. 137).Da die Verwendung signifikanter Symbole immer auch mit einer Selbstadressierungdes Symbole verwendenden Individuums einhergeht, geschieht <strong>Sprechen</strong>immer doppelt - adressiert werden immer das Gegen<strong>über</strong> und die eigene Person 41(vgl. auch Aboulafia 1991, S. 4). Lautgebärden sorgen <strong>als</strong>o <strong>für</strong> die automatischeAußenperspektive auf die eigene Person - eine notwendige Voraussetzung <strong>für</strong> dieEntwicklung sozialer Identität, wie im weiteren Verlauf dieses Kapitels deutlichwerden wird. Das Gespräch hat hierbei einen zentralen Stellenwert: Es ist daseinzige intersubjektive Verhalten, "in dem das Individuum gleichermaßen direkt<strong>sich</strong> <strong>selbst</strong> und die Folgehandlungen anderer zu beobachten vermag" (Düsing4041chen' werden wie ALTER. Auch hier findet <strong>sich</strong> eine Parallele zum <strong>Sprechen</strong>, denn die eigeneStimme hört man <strong>selbst</strong> natürlich ebenfalls nicht auf genau die gleiche Weise wie das Gegen<strong>über</strong>- der eigene Körper wirkt quasi <strong>als</strong> Klangkörper und verzerrt den akustischen Eindruck.Trotzdem bleibt die Form der Lautgeste erhalten; "Hund" bleibt "Hund", unabhängigdavon, ob ich mit normaler oder verstellter Stimme spreche.Die Lautgeste "zu Hause" kann <strong>als</strong>o je nach individueller Erfahrung den Inhalt eines HolzoderSteinhauses, einer Lehmhütte o.ä. nach <strong>sich</strong> ziehen; gemeint ist <strong>als</strong>o hier, dass jeweilsindividuelle Konzepte mit den Lautgesten verknüpft sind. Interessant wäre allerdings, wo genau<strong>sich</strong> z.B. sog. 'Teekesselchen' einordnen lassen - durch ihre sprachliche Gestalt sind siesignifikante Symbole, die allerdings auf mehrere mögliche Situationen verweisen und daherin ihrer Interpretation vom jeweiligen Kontext abhängig sind. Wenn aber die Gestenbedeutungdurch den Kontext und dessen Bedeutung mitbestimmt ist, handelt es <strong>sich</strong> nicht mehrum signifikante Symbole, sondern um nicht-signifikante, 'normale' Symbole. Ähnlich verhältes <strong>sich</strong> mit Privatwitzen, die in einem begrenzten Personenkreis verwendet und verstandenwerden. Auch wenn es <strong>sich</strong> der Form nach um signifikante Symbole handelt, ist auch hier derenBedeutung von einem bestimmten Situationsverständnis abhängig, die eine Nähe zumnicht-signifikanten Symbol anzeigt. Das Problem der Indexikalität kann durch das Vorgehender Konversationsanalyse angegangen werden - sie bietet ein Werkzeug, mit dem die <strong>Verfahren</strong>der SprecherInnen im Umgang mit Vagheit, Ambiguität usw. rekonstruiert werden können.Das 'Nachplappern' eines Papageis oder die szenische Darbietung von SchauspielerInnenkönnen allerdings nicht <strong>als</strong> Kommunikation im Mead'schen Sinn verstanden werden: Erstererverbindet keine Bedeutung mit den geäußerten Symbolen, kann <strong>sich</strong> <strong>als</strong>o nicht durch ihreVerwendung <strong>selbst</strong> adressieren. Letztere verbinden sehr wohl eine Bedeutung mit den vonihnen geäußerten Inhalten, tun aber nur so, '<strong>als</strong> ob': Immerhin soll ja eine Reaktion beim Publikumhervorgerufen werden, wenngleich die da<strong>für</strong> notwendige innere Haltung nicht vorhandenist (vgl. Mead 1968, S. 189). In Rückbezug auf diese Unterscheidung ließen <strong>sich</strong> die vonGoffman (1981) getroffenen Unterscheidungen zwischen verschiedenen Sprecherhaltungen(animator, author, principal, vgl. dazu auch Kap. 7.3) aus einer interessanten Perspektive betrachten.