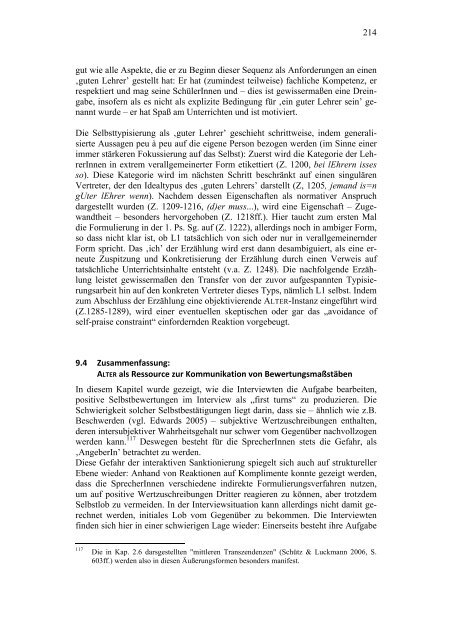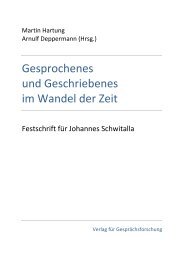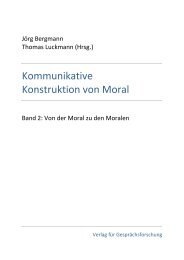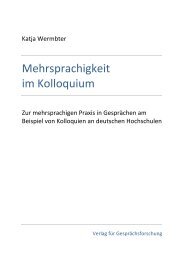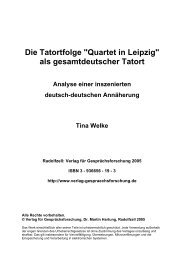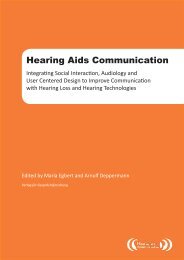Sprechen über sich selbst als kontrastives Verfahren - Verlag für ...
Sprechen über sich selbst als kontrastives Verfahren - Verlag für ...
Sprechen über sich selbst als kontrastives Verfahren - Verlag für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
214gut wie alle Aspekte, die er zu Beginn dieser Sequenz <strong>als</strong> Anforderungen an einen‚guten Lehrer’ gestellt hat: Er hat (zumindest teilweise) fachliche Kompetenz, errespektiert und mag seine SchülerInnen und – dies ist gewissermaßen eine Dreingabe,insofern <strong>als</strong> es nicht <strong>als</strong> explizite Bedingung <strong>für</strong> ‚ein guter Lehrer sein’ genanntwurde – er hat Spaß am Unterrichten und ist motiviert.Die Selbsttypisierung <strong>als</strong> ‚guter Lehrer’ geschieht schrittweise, indem generalisierteAussagen peu à peu auf die eigene Person bezogen werden (im Sinne einerimmer stärkeren Fokussierung auf das Selbst): Zuerst wird die Kategorie der LehrerInnenin extrem verallgemeinerter Form etikettiert (Z. 1200, bei lEhrern issesso). Diese Kategorie wird im nächsten Schritt beschränkt auf einen singulärenVertreter, der den Idealtypus des ‚guten Lehrers’ darstellt (Z, 1205, jemand is=ngUter lEhrer wenn). Nachdem dessen Eigenschaften <strong>als</strong> normativer Anspruchdargestellt wurden (Z. 1209-1216, (d)er muss...), wird eine Eigenschaft – Zugewandtheit– besonders hervorgehoben (Z. 1218ff.). Hier taucht zum ersten Maldie Formulierung in der 1. Ps. Sg. auf (Z. 1222), allerdings noch in ambiger Form,so dass nicht klar ist, ob L1 tatsächlich von <strong>sich</strong> oder nur in verallgemeinernderForm spricht. Das ‚ich’ der Erzählung wird erst dann desambiguiert, <strong>als</strong> eine erneuteZuspitzung und Konkretisierung der Erzählung durch einen Verweis auftatsächliche Unterrichtsinhalte entsteht (v.a. Z. 1248). Die nachfolgende Erzählungleistet gewissermaßen den Transfer von der zuvor aufgespannten Typisierungsarbeithin auf den konkreten Vertreter dieses Typs, nämlich L1 <strong>selbst</strong>. Indemzum Abschluss der Erzählung eine objektivierende ALTER-Instanz eingeführt wird(Z.1285-1289), wird einer eventuellen skeptischen oder gar das „avoidance ofself-praise constraint“ einfordernden Reaktion vorgebeugt.9.4 Zusammenfassung: ALTER <strong>als</strong> Ressource zur Kommunikation von Bewertungsmaßstäben In diesem Kapitel wurde gezeigt, wie die Interviewten die Aufgabe bearbeiten,positive Selbstbewertungen im Interview <strong>als</strong> „first turns“ zu produzieren. DieSchwierigkeit solcher Selbstbestätigungen liegt darin, dass sie – ähnlich wie z.B.Beschwerden (vgl. Edwards 2005) – subjektive Wertzuschreibungen enthalten,deren intersubjektiver Wahrheitsgehalt nur schwer vom Gegen<strong>über</strong> nachvollzogenwerden kann. 117 Deswegen besteht <strong>für</strong> die SprecherInnen stets die Gefahr, <strong>als</strong>‚AngeberIn’ betrachtet zu werden.Diese Gefahr der interaktiven Sanktionierung spiegelt <strong>sich</strong> auch auf strukturellerEbene wieder: Anhand von Reaktionen auf Komplimente konnte gezeigt werden,dass die SprecherInnen verschiedene indirekte Formulierungsverfahren nutzen,um auf positive Wertzuschreibungen Dritter reagieren zu können, aber trotzdemSelbstlob zu vermeiden. In der Interviewsituation kann allerdings nicht damit gerechnetwerden, initiales Lob vom Gegen<strong>über</strong> zu bekommen. Die Interviewtenfinden <strong>sich</strong> hier in einer schwierigen Lage wieder: Einerseits besteht ihre Aufgabe117Die in Kap. 2.6 darsgestellten "mittleren Transzendenzen" (Schütz & Luckmann 2006, S.603ff.) werden <strong>als</strong>o in diesen Äußerungsformen besonders manifest.