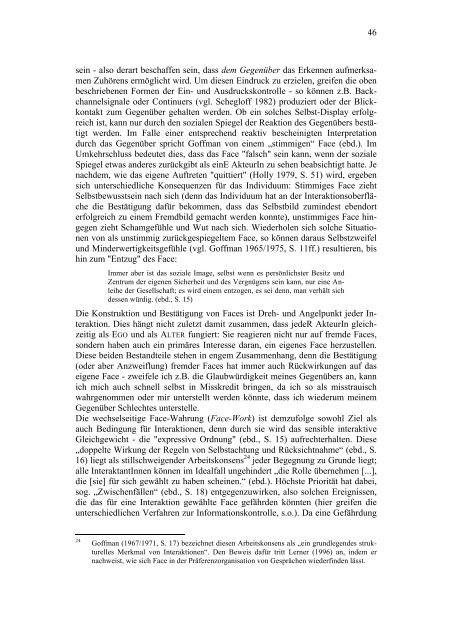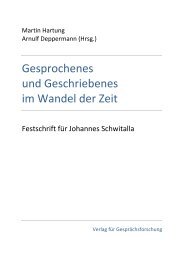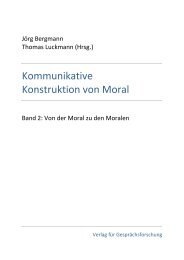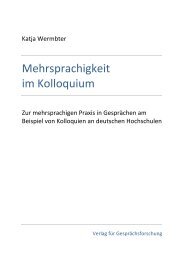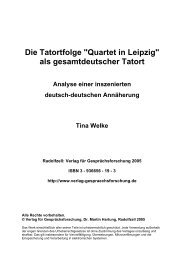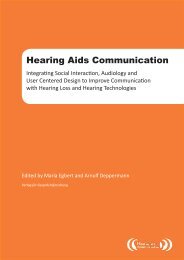Sprechen über sich selbst als kontrastives Verfahren - Verlag für ...
Sprechen über sich selbst als kontrastives Verfahren - Verlag für ...
Sprechen über sich selbst als kontrastives Verfahren - Verlag für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
46sein - <strong>als</strong>o derart beschaffen sein, dass dem Gegen<strong>über</strong> das Erkennen aufmerksamenZuhörens ermöglicht wird. Um diesen Eindruck zu erzielen, greifen die obenbeschriebenen Formen der Ein- und Ausdruckskontrolle - so können z.B. Backchannelsignaleoder Continuers (vgl. Schegloff 1982) produziert oder der Blickkontaktzum Gegen<strong>über</strong> gehalten werden. Ob ein solches Selbst-Display erfolgreichist, kann nur durch den sozialen Spiegel der Reaktion des Gegen<strong>über</strong>s bestätigtwerden. Im Falle einer entsprechend reaktiv bescheinigten Interpretationdurch das Gegen<strong>über</strong> spricht Goffman von einem „stimmigen“ Face (ebd.). ImUmkehrschluss bedeutet dies, dass das Face "f<strong>als</strong>ch" sein kann, wenn der sozialeSpiegel etwas anderes zurückgibt <strong>als</strong> einE AkteurIn zu sehen beab<strong>sich</strong>tigt hatte. Jenachdem, wie das eigene Auftreten "quittiert" (Holly 1979, S. 51) wird, ergeben<strong>sich</strong> unterschiedliche Konsequenzen <strong>für</strong> das Individuum: Stimmiges Face ziehtSelbstbewusstsein nach <strong>sich</strong> (denn das Individuum hat an der Interaktionsoberflächedie Bestätigung da<strong>für</strong> bekommen, dass das Selbstbild zumindest ebendorterfolgreich zu einem Fremdbild gemacht werden konnte), unstimmiges Face hingegenzieht Schamgefühle und Wut nach <strong>sich</strong>. Wiederholen <strong>sich</strong> solche Situationenvon <strong>als</strong> unstimmig zurückgespiegeltem Face, so können daraus Selbstzweifelund Minderwertigkeitsgefühle (vgl. Goffman 1965/1975, S. 11ff.) resultieren, bishin zum "Entzug" des Face:Immer aber ist das soziale Image, <strong>selbst</strong> wenn es persönlichster Besitz undZentrum der eigenen Sicherheit und des Vergnügens sein kann, nur eine Anleiheder Gesellschaft; es wird einem entzogen, es sei denn, man verhält <strong>sich</strong>dessen würdig. (ebd., S. 15)Die Konstruktion und Bestätigung von Faces ist Dreh- und Angelpunkt jeder Interaktion.Dies hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass jedeR AkteurIn gleichzeitig<strong>als</strong> EGO und <strong>als</strong> ALTER fungiert: Sie reagieren nicht nur auf fremde Faces,sondern haben auch ein primäres Interesse daran, ein eigenes Face herzustellen.Diese beiden Bestandteile stehen in engem Zusammenhang, denn die Bestätigung(oder aber Anzweiflung) fremder Faces hat immer auch Rückwirkungen auf daseigene Face - zweifele ich z.B. die Glaubwürdigkeit meines Gegen<strong>über</strong>s an, kannich mich auch schnell <strong>selbst</strong> in Misskredit bringen, da ich so <strong>als</strong> misstrauischwahrgenommen oder mir unterstellt werden könnte, dass ich wiederum meinemGegen<strong>über</strong> Schlechtes unterstelle.Die wechselseitige Face-Wahrung (Face-Work) ist demzufolge sowohl Ziel <strong>als</strong>auch Bedingung <strong>für</strong> Interaktionen, denn durch sie wird das sensible interaktiveGleichgewicht - die "expressive Ordnung" (ebd., S. 15) aufrechterhalten. Diese„doppelte Wirkung der Regeln von Selbstachtung und Rück<strong>sich</strong>tnahme“ (ebd., S.16) liegt <strong>als</strong> stillschweigender Arbeitskonsens 24 jeder Begegnung zu Grunde liegt;alle InteraktantInnen können im Idealfall ungehindert „die Rolle <strong>über</strong>nehmen [...],die [sie] <strong>für</strong> <strong>sich</strong> gewählt zu haben scheinen.“ (ebd.). Höchste Priorität hat dabei,sog. „Zwischenfällen“ (ebd., S. 18) entgegenzuwirken, <strong>als</strong>o solchen Ereignissen,die das <strong>für</strong> eine Interaktion gewählte Face gefährden könnten (hier greifen dieunterschiedlichen <strong>Verfahren</strong> zur Informationskontrolle, s.o.). Da eine Gefährdung24Goffman (1967/1971, S. 17) bezeichnet diesen Arbeitskonsens <strong>als</strong> „ein grundlegendes strukturellesMerkmal von Interaktionen“. Den Beweis da<strong>für</strong> tritt Lerner (1996) an, indem ernachweist, wie <strong>sich</strong> Face in der Präferenzorganisation von Gesprächen wiederfinden lässt.