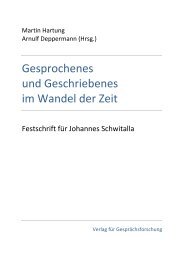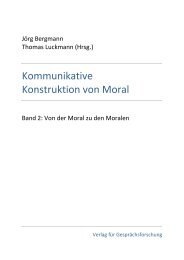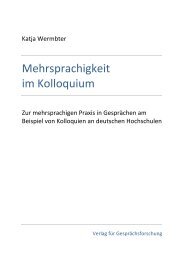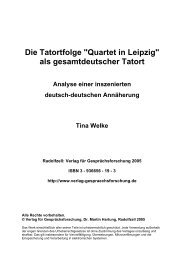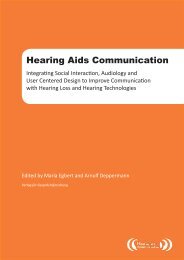Sprechen über sich selbst als kontrastives Verfahren - Verlag für ...
Sprechen über sich selbst als kontrastives Verfahren - Verlag für ...
Sprechen über sich selbst als kontrastives Verfahren - Verlag für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
191Biographie dargestellt wurde: EinE SprecherIn muss zunächst einmal <strong>über</strong> <strong>Verfahren</strong>verfügen, mit denen er/sie <strong>sich</strong> <strong>selbst</strong> <strong>als</strong> Objekt darstellen kann, um vomGegen<strong>über</strong> <strong>als</strong> Objekt interpretiert werden zu können. Da<strong>für</strong> muss er/sie weiterhinantizipieren können, wie das Gegen<strong>über</strong> die verbalisierte Form der eigenenSelbstobjektivierung interpretieren könnte, damit diese in entsprechender Formkommuniziert werden kann. Dies wird durch die unten beschriebenen <strong>Verfahren</strong><strong>sich</strong>ergestellt.9.2 Selbstevaluationen <strong>als</strong> interaktives Problem Holly (1979) bezeichnet positive und negative Selbst- bzw. Partnerbewertungen<strong>als</strong> die vier "Grundtypen ritueller Bewertungen" (ebd., S. 75ff.). Eine Sonderrollenimmt dabei die postive Bewertung der eigenen Person ein („Selbstbestätigung“,ebd. 105 ). Dies hängt damit zusammen, dass Selbstbewertungen nicht ganz unproblematischeÄußerungsformen sind, bei deren Produktion <strong>sich</strong> die SprecherInnenvor allem auf Ebene des Face-Works an verschiedenen Einschränkungen („constraints“,vgl. v.a. Pomerantz 1978) orientieren.9.2.1 „Compliment responses“ und die Vermeidung von Selbstlob In ihrer Untersuchung von „Compliment Responses“ konnte Pomerantz (1978)zeigen, dass Reaktionen auf Komplimente im amerikanischen Sprachraum durchdrei unterschiedliche Systeme reguliert werden, die <strong>sich</strong> zum Teil ergänzen, zumTeil aber auch gegenseitig behindern. Das erste System bezieht <strong>sich</strong> auf Zustimmungoder Ablehnung <strong>als</strong> mögliche Reaktion auf die in einem Kompliment enthalteneWertung. Zustimmungen sind dabei die strukturell präferierte Variante,Ablehnungen werden <strong>als</strong> dispräferiert markiert produziert. Das zweite Systemkooperiert in gewisser Weise mit dem ersten: Es bezieht <strong>sich</strong> auf die Annahmeoder Ablehnung eines Kompliments. Hier werden Annahmen <strong>als</strong> präferiert undAblehnungen <strong>als</strong> dispräferiert markiert, so dass die ‚ideale’, weil präferierte, Reaktionauf ein Kompliment in einer Zustimmung und einer Annahme besteht. DieKooperation dieser beiden Systeme wird allerdings beeinträchtigt durch ein drittesSystem, das die konkrete Ausgestaltung von Reaktionen auf Komplimente maßgeblichbeeinflusst: Parallel zu den beiden oben beschriebenen Systemen bestehtnämlich drittens gleichzeitig die Einschränkung, Selbstlob möglichst zu minimierenbzw. sogar zu vermeiden. Dies konfligiert mit der ja eigentlich präferiertenReaktion auf Komplimente, denn indem die SprecherInnen ein Kompliment annehmenund ihm dadurch zustimmen, bestätigen sie gleichzeitig die im Komplimententhaltene positive Bewertung der eigenen Person und produzieren so einindirektes Selbstlob. Ein Verstoß gegen dieses dritte System kann sowohl von denSprecherInnen <strong>als</strong> auch von den KomplimentrezipientInnen thematisiert werden:If self-praise is performed by a speaker, that is, if a speaker does not enforceupon himself self-praise avoidance, a recipient may in next turn make noticeof the violation and enforce the constraints. (Pomerantz 1978, S. 88)105Die Begriffe ‚positive Selbstbewertung’ und ‚Selbstbestätigung’ werden im Folgenden synonymverwendet.