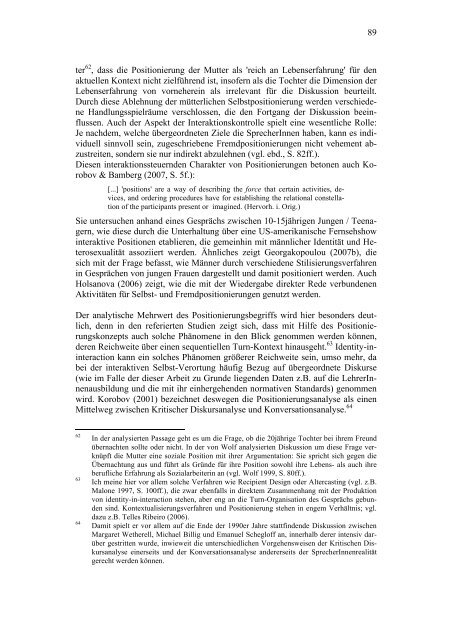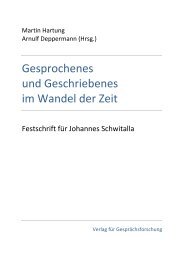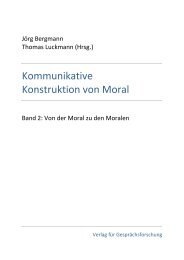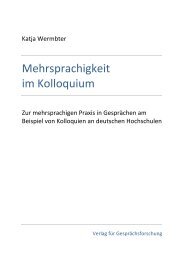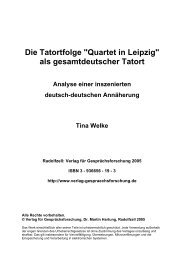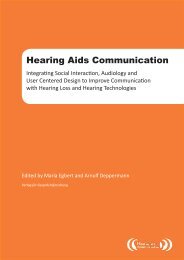Sprechen über sich selbst als kontrastives Verfahren - Verlag für ...
Sprechen über sich selbst als kontrastives Verfahren - Verlag für ...
Sprechen über sich selbst als kontrastives Verfahren - Verlag für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
89ter 62 , dass die Positionierung der Mutter <strong>als</strong> 'reich an Lebenserfahrung' <strong>für</strong> denaktuellen Kontext nicht zielführend ist, insofern <strong>als</strong> die Tochter die Dimension derLebenserfahrung von vorneherein <strong>als</strong> irrelevant <strong>für</strong> die Diskussion beurteilt.Durch diese Ablehnung der mütterlichen Selbstpositionierung werden verschiedeneHandlungsspielräume verschlossen, die den Fortgang der Diskussion beeinflussen.Auch der Aspekt der Interaktionskontrolle spielt eine wesentliche Rolle:Je nachdem, welche <strong>über</strong>geordneten Ziele die SprecherInnen haben, kann es individuellsinnvoll sein, zugeschriebene Fremdpositionierungen nicht vehement abzustreiten,sondern sie nur indirekt abzulehnen (vgl. ebd., S. 82ff.).Diesen interaktionssteuernden Charakter von Positionierungen betonen auch Korobov& Bamberg (2007, S. 5f.):[...] 'positions' are a way of describing the force that certain activities, devices,and ordering procedures have for establishing the relational constellationof the participants present or imagined. (Hervorh. i. Orig.)Sie untersuchen anhand eines Gesprächs zwischen 10-15jährigen Jungen / Teenagern,wie diese durch die Unterhaltung <strong>über</strong> eine US-amerikanische Fernsehshowinteraktive Positionen etablieren, die gemeinhin mit männlicher Identität und Heterosexualitätassoziiert werden. Ähnliches zeigt Georgakopoulou (2007b), die<strong>sich</strong> mit der Frage befasst, wie Männer durch verschiedene Stilisierungsverfahrenin Gesprächen von jungen Frauen dargestellt und damit positioniert werden. AuchHolsanova (2006) zeigt, wie die mit der Wiedergabe direkter Rede verbundenenAktivitäten <strong>für</strong> Selbst- und Fremdpositionierungen genutzt werden.Der analytische Mehrwert des Positionierungsbegriffs wird hier besonders deutlich,denn in den referierten Studien zeigt <strong>sich</strong>, dass mit Hilfe des Positionierungskonzeptsauch solche Phänomene in den Blick genommen werden können,deren Reichweite <strong>über</strong> einen sequentiellen Turn-Kontext hinausgeht. 63 Identity-ininteractionkann ein solches Phänomen größerer Reichweite sein, umso mehr, dabei der interaktiven Selbst-Verortung häufig Bezug auf <strong>über</strong>geordnete Diskurse(wie im Falle der dieser Arbeit zu Grunde liegenden Daten z.B. auf die LehrerInnenausbildungund die mit ihr einhergehenden normativen Standards) genommenwird. Korobov (2001) bezeichnet deswegen die Positionierungsanalyse <strong>als</strong> einenMittelweg zwischen Kritischer Diskursanalyse und Konversationsanalyse. 64626364In der analysierten Passage geht es um die Frage, ob die 20jährige Tochter bei ihrem Freund<strong>über</strong>nachten sollte oder nicht. In der von Wolf analysierten Diskussion um diese Frage verknüpftdie Mutter eine soziale Position mit ihrer Argumentation: Sie spricht <strong>sich</strong> gegen dieÜbernachtung aus und führt <strong>als</strong> Gründe <strong>für</strong> ihre Position sowohl ihre Lebens- <strong>als</strong> auch ihreberufliche Erfahrung <strong>als</strong> Sozialarbeiterin an (vgl. Wolf 1999, S. 80ff.).Ich meine hier vor allem solche <strong>Verfahren</strong> wie Recipient Design oder Altercasting (vgl. z.B.Malone 1997, S. 100ff.), die zwar ebenfalls in direktem Zusammenhang mit der Produktionvon identity-in-interaction stehen, aber eng an die Turn-Organisation des Gesprächs gebundensind. Kontextualisierungsverfahren und Positionierung stehen in engem Verhältnis; vgl.dazu z.B. Telles Ribeiro (2006).Damit spielt er vor allem auf die Ende der 1990er Jahre stattfindende Diskussion zwischenMargaret Wetherell, Michael Billig und Emanuel Schegloff an, innerhalb derer intensiv dar<strong>über</strong>gestritten wurde, inwieweit die unterschiedlichen Vorgehensweisen der Kritischen Diskursanalyseeinerseits und der Konversationsanalyse andererseits der SprecherInnenrealitätgerecht werden können.