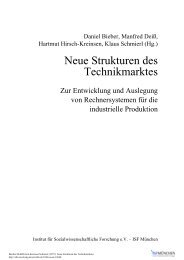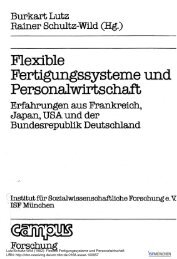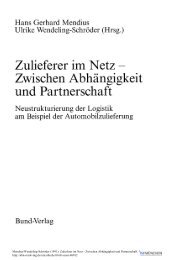- Seite 1 und 2:
Daniel Bieber, Gerd Möll Techniken
- Seite 3 und 4:
Veröffentlichungen aus dem Institu
- Seite 5 und 6:
Vorwort I. Dieser nunmehr einer bre
- Seite 7 und 8:
Verpflichtet sind wir auch den Mita
- Seite 9 und 10:
Inhalt Vorwort 1 Verzeichnis der Ab
- Seite 11 und 12:
6.5 Finanzierungsformen von Forschu
- Seite 13 und 14:
Verzeichnis der Abbildungen Abb. 2.
- Seite 15 und 16:
Tab. 5.16: Beschäftigungsstruktur
- Seite 17 und 18:
Teil A Desiderate der industriesozi
- Seite 19 und 20:
1. Einleitung "Mit Grund kann daher
- Seite 21 und 22:
ung des materiellen Produktionsproz
- Seite 23 und 24:
der organisationsstrukturellen Rahm
- Seite 25 und 26:
"Modernisten" über die richtige Pr
- Seite 27 und 28:
Da man, ohne einem negativ gefärbt
- Seite 29 und 30:
Vor allem in den als verwissenschaf
- Seite 31 und 32:
verschärfenden Zwangs zur Produkti
- Seite 33 und 34:
len und dezentralen Organisationsfo
- Seite 35 und 36:
Tätigkeiten des Unternehmens einer
- Seite 37 und 38:
mehr, als insbesondere im Bereich d
- Seite 39 und 40: Hinsicht eine Schlüsselrolle zu. Z
- Seite 41 und 42: striesoziologie der 70er und 80er J
- Seite 43 und 44: probleme in den Arbeiten der neuere
- Seite 45 und 46: (3) In welcher Weise manifestiert s
- Seite 47 und 48: TeilB Was kann die Industriesoziolo
- Seite 49 und 50: 2. Veränderte Bedingungen von Unte
- Seite 51 und 52: Marktökonomie kollidiere (Brandt u
- Seite 53 und 54: und Teilprozessen des Produktionsab
- Seite 55 und 56: zung beigetragen hat, angesichts ve
- Seite 57 und 58: theorem entwickelt wurden, "sich au
- Seite 59 und 60: dezu apokalyptische Interpretatione
- Seite 61 und 62: onstheorems zurück. Dieser besteht
- Seite 63 und 64: materiellen Arbeit hinaus auszudehn
- Seite 65 und 66: listischer Gesellschaften die Vermu
- Seite 67 und 68: deutung der Arbeit für die Reprodu
- Seite 69 und 70: je bestimmten Modi der Regulation (
- Seite 71 und 72: tischer Überlegungen zu machen. Al
- Seite 73 und 74: 3. Annäherungen an das Thema "Inno
- Seite 75 und 76: neuen Fertigungsverfahrens oder ein
- Seite 77 und 78: der beiden Innovationsbegriffe. Imp
- Seite 79 und 80: 3.2 Prozessualer Innovationsbegriff
- Seite 81 und 82: Mittlerweile wird kaum noch bestrit
- Seite 83 und 84: können. Die gegenwärtig bei der O
- Seite 85 und 86: Frage nachgehen, mit welchen Mittel
- Seite 87 und 88: Weitbedingungen auch bestimmte Stru
- Seite 89: Produkt- und Prozeßtechnologien -
- Seite 93 und 94: existiere eine, von den spezifische
- Seite 95 und 96: Die Bedeutung des Einflusses unters
- Seite 97 und 98: estimmten Punkt getroffene "richtig
- Seite 99 und 100: Ebene des Arbeitsprozesses adäquat
- Seite 101 und 102: (1) Die geringe wissenschaftliche B
- Seite 103 und 104: "Large corporations invested in res
- Seite 105 und 106: Es fragt sich allerdings, wie und b
- Seite 107 und 108: Umsatz bzw. an der Umsatzrendite ni
- Seite 109 und 110: 3.5 Bedingungen unternehmerischer F
- Seite 111 und 112: "daß es keinen Grund gibt anzunehm
- Seite 113 und 114: Quelle: Freeman, 1974 Abbildung 3.3
- Seite 115 und 116: Bieber/Möll (1993): Technikentwick
- Seite 117 und 118: den - im Gegenteil. Wie man diesen
- Seite 119 und 120: of concepts and ideas; the integrat
- Seite 121 und 122: nologien zusammenhängende Unsicher
- Seite 123 und 124: schen Bezug und den unterschiedlich
- Seite 125 und 126: eitsprozesses "von oben" in das Unt
- Seite 127 und 128: nehmens durchaus nicht nur auf die
- Seite 129 und 130: Angestelltenarbeit bedeutsam waren.
- Seite 131 und 132: und Schumann (vgl. Bechtle, Lutz 19
- Seite 133 und 134: tionalisierung ist dieser Interpret
- Seite 135 und 136: Analyse, als ausschließliches Zent
- Seite 137 und 138: greifende Kooperation bei der Produ
- Seite 139 und 140: eispielsweise von Baethge und Oberb
- Seite 141 und 142:
die Unternehmensstrategie nahezu vo
- Seite 143 und 144:
ven Konzept zu gelangen. Neben gewi
- Seite 145 und 146:
TeilC Branchenanalyse der Elektro-
- Seite 147 und 148:
"Man kann davon ausgehen, daß das
- Seite 149 und 150:
analyse von J. Goldberg (1985), der
- Seite 151 und 152:
5. Die ökonomische Struktur der El
- Seite 153 und 154:
Diese wiederum lassen sich grob in
- Seite 155 und 156:
wird, der diese Beschränkung auf b
- Seite 157 und 158:
triert (Czada 1969), und die deutsc
- Seite 159 und 160:
Gesamtprodukt und verändert nachha
- Seite 161 und 162:
Rolle. Lediglich ein Drittel des In
- Seite 163 und 164:
Büro und Handel Elektronisches Not
- Seite 165 und 166:
Die größten Wachstumsraten werden
- Seite 167 und 168:
"Bei der Entwicklung von Großrechn
- Seite 169 und 170:
Tab. 5.5: Der Markt für Software i
- Seite 171 und 172:
Wertschöpfungsprozeß verändert.
- Seite 173 und 174:
IBM liefert noch weitere Indizien f
- Seite 175 und 176:
5.4 Produktions- und Absatzstruktur
- Seite 177 und 178:
wieweit damit auch verstärkte Anst
- Seite 179 und 180:
Elektronikindustrie gelten. Die Son
- Seite 181 und 182:
5.6 Außenhandel Die Elektrotechnis
- Seite 183 und 184:
lativ arbeitsintensiv. Betrachtet m
- Seite 185 und 186:
der FuE-Abteilungen mindestens teil
- Seite 187 und 188:
Zwar zeigten die Umsatzzahlen auch
- Seite 189 und 190:
Gebrauchsgütern, die seit geraumer
- Seite 191 und 192:
Tab. 5.13: Investitionsquoten in de
- Seite 193 und 194:
Bieber/Möll (1993): Technikentwick
- Seite 195 und 196:
Zeiträumen seit 1968 liegt die dur
- Seite 197 und 198:
zahlreiche Anhaltspunkte dafür, da
- Seite 199 und 200:
Tab. 5.17: Anteil der Angestellten
- Seite 201 und 202:
6. Wissenschaftlich-technologisches
- Seite 203 und 204:
Diese Vorbedingungen verweisen dara
- Seite 205 und 206:
Ebenso schwierig wie die Differenzi
- Seite 207 und 208:
"Faßt man zusammen, so erkennt man
- Seite 209 und 210:
Patente erlauben. Zudem werden insb
- Seite 211 und 212:
teil, der mit Produkten erzielt wir
- Seite 213 und 214:
Unternehmen zu relativieren. Unsere
- Seite 215 und 216:
Bieber/Möll (1993): Technikentwick
- Seite 217 und 218:
Abstand zu den übrigen Bereichen i
- Seite 219 und 220:
Volumen von 14 bis 16 Mrd. DM und l
- Seite 221 und 222:
Deutlich zu erkennen ist hier ein n
- Seite 223 und 224:
6.5 Finanzierungsformen von Forschu
- Seite 225 und 226:
Bereich der Elektroindustrie eine e
- Seite 227 und 228:
Bieber/Möll (1993): Technikentwick
- Seite 229 und 230:
sich größtenteils durch die Berü
- Seite 231 und 232:
Weiterhin ist zu beachten, daß in
- Seite 233 und 234:
Bieber/Möll (1993): Technikentwick
- Seite 235 und 236:
tenden Gewerbes liegen. Wegen des h
- Seite 237 und 238:
verwendet wurden, die sich an die V
- Seite 239 und 240:
dungen außerhalb des FuE-Bereichs
- Seite 241 und 242:
wicklung, Konstruktion und Prozeßi
- Seite 243 und 244:
Trotz der notierten Unklarheiten de
- Seite 245 und 246:
(2) Bei den FuE-Beschäftigten zeic
- Seite 247 und 248:
TeilD Strategien und Strukturen inn
- Seite 249 und 250:
Einleitung Die Liste von Elektrount
- Seite 251 und 252:
Maße Handlungsfeld unternehmerisch
- Seite 253 und 254:
wird. Schon jetzt lassen sich ähnl
- Seite 255 und 256:
7. Neue Formen der Unternehmensorga
- Seite 257 und 258:
Bieber/Möll (1993): Technikentwick
- Seite 259 und 260:
7.2 Modifikation divisionaler Unter
- Seite 261 und 262:
Bieber/Möll (1993): Technikentwick
- Seite 263 und 264:
Bieber/Möll (1993): Technikentwick
- Seite 265 und 266:
Flexibilität und Innovationsfähig
- Seite 267 und 268:
Auf diese Weise wird die Innovation
- Seite 269 und 270:
Orientierung des Gesamtkonzerns. 12
- Seite 271 und 272:
8. Die Innovation von Innovationspr
- Seite 273 und 274:
der Produktionsabteilungen bei der
- Seite 275 und 276:
Bei verkürzten Produktlebenszyklen
- Seite 277 und 278:
Das Schlüsselprinzip des Simultane
- Seite 279 und 280:
drei Stufen eine Guttmansche Skala,
- Seite 281 und 282:
ses, also auch für Forschung und E
- Seite 283 und 284:
lerdings sind die Endhersteller bes
- Seite 285 und 286:
hendet u.a bezeichnen diesen Wandel
- Seite 287 und 288:
Herstellung hochreiner Einkristalle
- Seite 289 und 290:
ei den Funktionskeramiken eine ries
- Seite 291 und 292:
vationstempos und der gestiegenen K
- Seite 293 und 294:
Sie wird nicht auf hochinnovative P
- Seite 295 und 296:
anderem zurückzuführen, daß den
- Seite 297 und 298:
nen, daß technologische Innovation
- Seite 299 und 300:
gen im Bereich der Fertigung wenn n
- Seite 301 und 302:
9. Externe Arrangements zur Minimie
- Seite 303 und 304:
Die Fähigkeit zur Innovation allei
- Seite 305 und 306:
tionsformen mit bestimmten Subbranc
- Seite 307 und 308:
nungsvorhaben (z.B. im Investitions
- Seite 309 und 310:
Personalwesen und Finanzierung. Ein
- Seite 311 und 312:
schen Forschung erhalten Lizenzprod
- Seite 313 und 314:
Mitgliedern gehören 14 führende H
- Seite 315 und 316:
lich werden lassen: Zum einen reich
- Seite 317 und 318:
auszuwechseln), dann spricht das eh
- Seite 319 und 320:
Groß- und Kleinrechnern erleichter
- Seite 321 und 322:
Ausgaben für die Entwicklung markt
- Seite 323 und 324:
Dies sind nur einige Belege für di
- Seite 325 und 326:
Die Tatsache, daß bei Kooperatione
- Seite 327 und 328:
joint-ventures als neuer Institutio
- Seite 329 und 330:
Gemeinschaftsunternehmen durchaus i
- Seite 331 und 332:
Über die derzeitige Bedeutung dies
- Seite 333 und 334:
die Forschung und Entwicklung von I
- Seite 335 und 336:
Abbau von Doppelarbeit und darüber
- Seite 337 und 338:
Zuvor beabsichtigte Siemens schon d
- Seite 339 und 340:
gen sowie der Elektrifizierung von
- Seite 341 und 342:
auf den Märkten für elektrotechni
- Seite 343 und 344:
iken, die zu unterschiedlichen Bere
- Seite 345 und 346:
duction, to tap into sources of kno
- Seite 347 und 348:
"dominant coalition" (Child) eines
- Seite 349 und 350:
nen, 131 stellen keine Überwindung
- Seite 351 und 352:
(7) Die in diesem Kapitel thematisi
- Seite 353 und 354:
TeilE Geht der Industriesoziologie
- Seite 355 und 356:
10. Innovation, Organisation und In
- Seite 357 und 358:
der Industrie unter dem Stichwort "
- Seite 359 und 360:
terpretation von Veränderungen in
- Seite 361 und 362:
meist allenfalls Gegenstand von For
- Seite 363 und 364:
tungszunahme von FuE und marktnahen
- Seite 365 und 366:
(1) Veränderungen der Unternehmens
- Seite 367 und 368:
erhöhte Anstrengungen zur Informat
- Seite 369 und 370:
schlägen von Bedeutung. 15 Dadurch
- Seite 371 und 372:
kontextfreies, abstraktifiziertes P
- Seite 373 und 374:
eilen Innovationsprozessen. Dements
- Seite 375 und 376:
die Laboratorien als Orte der Erzeu
- Seite 377 und 378:
10.8 Gesamtgesellschaftliche Aspekt
- Seite 379 und 380:
Die Diskussion über den Wandel mod
- Seite 381 und 382:
tätsperiode auch die hinreichenden
- Seite 383 und 384:
Literatur Adorno, Th.W. (1969): Ein
- Seite 385 und 386:
Bergen, SA. (1986): Project Managem
- Seite 387 und 388:
Brandt, G.; Papadimitriou, Z. (1983
- Seite 389 und 390:
Coombs, R. (1985): Automation, Mana
- Seite 391 und 392:
Faber, C; Wehrsig, C. (Hrsg.) (1989
- Seite 393 und 394:
Hamilton, E.F. (1985): Corporate St
- Seite 395 und 396:
Knights, D.; Willmott, H. (eds.) (1
- Seite 397 und 398:
Malsch, Th. (1984): Erfahrungswisse
- Seite 399 und 400:
Petroni, G. (1983): Strategie Plann
- Seite 401 und 402:
Sauer, D. (1989): Neuer Rationalisi
- Seite 403 und 404:
Statistisches Bundesamt Wiesbaden (
- Seite 405 und 406:
Wittemann, K.P.; Wittke, V.: Zur Ab
- Seite 407 und 408:
Ausgewählte Buchveröffentlichunge