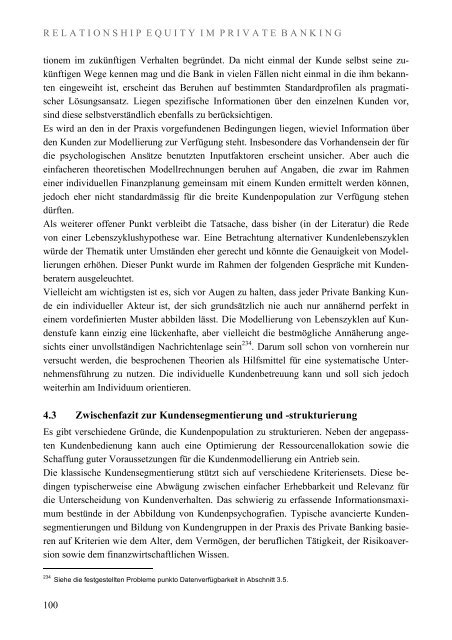Relationship Equity im Private Banking - Universität St.Gallen
Relationship Equity im Private Banking - Universität St.Gallen
Relationship Equity im Private Banking - Universität St.Gallen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
R E L A T I O N S H I P E Q U I T Y I M P R I V A T E B A N K I N G<br />
tionem <strong>im</strong> zukünftigen Verhalten begründet. Da nicht einmal der Kunde selbst seine zukünftigen<br />
Wege kennen mag und die Bank in vielen Fällen nicht einmal in die ihm bekannten<br />
eingeweiht ist, erscheint das Beruhen auf best<strong>im</strong>mten <strong>St</strong>andardprofilen als pragmatischer<br />
Lösungsansatz. Liegen spezifische Informationen über den einzelnen Kunden vor,<br />
sind diese selbstverständlich ebenfalls zu berücksichtigen.<br />
Es wird an den in der Praxis vorgefundenen Bedingungen liegen, wieviel Information über<br />
den Kunden zur Modellierung zur Verfügung steht. Insbesondere das Vorhandensein der für<br />
die psychologischen Ansätze benutzten Inputfaktoren erscheint unsicher. Aber auch die<br />
einfacheren theoretischen Modellrechnungen beruhen auf Angaben, die zwar <strong>im</strong> Rahmen<br />
einer individuellen Finanzplanung gemeinsam mit einem Kunden ermittelt werden können,<br />
jedoch eher nicht standardmässig für die breite Kundenpopulation zur Verfügung stehen<br />
dürften.<br />
Als weiterer offener Punkt verbleibt die Tatsache, dass bisher (in der Literatur) die Rede<br />
von einer Lebenszyklushypothese war. Eine Betrachtung alternativer Kundenlebenszyklen<br />
würde der Thematik unter Umständen eher gerecht und könnte die Genauigkeit von Modellierungen<br />
erhöhen. Dieser Punkt wurde <strong>im</strong> Rahmen der folgenden Gespräche mit Kundenberatern<br />
ausgeleuchtet.<br />
Vielleicht am wichtigsten ist es, sich vor Augen zu halten, dass jeder <strong>Private</strong> <strong>Banking</strong> Kunde<br />
ein individueller Akteur ist, der sich grundsätzlich nie auch nur annähernd perfekt in<br />
einem vordefinierten Muster abbilden lässt. Die Modellierung von Lebenszyklen auf Kundenstufe<br />
kann einzig eine lückenhafte, aber vielleicht die bestmögliche Annäherung angesichts<br />
einer unvollständigen Nachrichtenlage sein 234 . Darum soll schon von vornherein nur<br />
versucht werden, die besprochenen Theorien als Hilfsmittel für eine systematische Unternehmensführung<br />
zu nutzen. Die individuelle Kundenbetreuung kann und soll sich jedoch<br />
weiterhin am Individuum orientieren.<br />
4.3 Zwischenfazit zur Kundensegmentierung und -strukturierung<br />
Es gibt verschiedene Gründe, die Kundenpopulation zu strukturieren. Neben der angepassten<br />
Kundenbedienung kann auch eine Opt<strong>im</strong>ierung der Ressourcenallokation sowie die<br />
Schaffung guter Voraussetzungen für die Kundenmodellierung ein Antrieb sein.<br />
Die klassische Kundensegmentierung stützt sich auf verschiedene Kriteriensets. Diese bedingen<br />
typischerweise eine Abwägung zwischen einfacher Erhebbarkeit und Relevanz für<br />
die Unterscheidung von Kundenverhalten. Das schwierig zu erfassende Informationsmax<strong>im</strong>um<br />
bestünde in der Abbildung von Kundenpsychografien. Typische avancierte Kundensegmentierungen<br />
und Bildung von Kundengruppen in der Praxis des <strong>Private</strong> <strong>Banking</strong> basieren<br />
auf Kriterien wie dem Alter, dem Vermögen, der beruflichen Tätigkeit, der Risikoaversion<br />
sowie dem finanzwirtschaftlichen Wissen.<br />
234 Siehe die festgestellten Probleme punkto Datenverfügbarkeit in Abschnitt 3.5.<br />
100