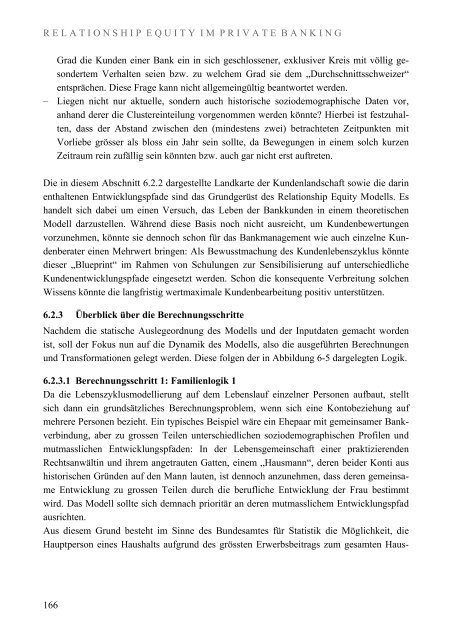Relationship Equity im Private Banking - Universität St.Gallen
Relationship Equity im Private Banking - Universität St.Gallen
Relationship Equity im Private Banking - Universität St.Gallen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
R E L A T I O N S H I P E Q U I T Y I M P R I V A T E B A N K I N G<br />
Grad die Kunden einer Bank ein in sich geschlossener, exklusiver Kreis mit völlig gesondertem<br />
Verhalten seien bzw. zu welchem Grad sie dem „Durchschnittsschweizer“<br />
entsprächen. Diese Frage kann nicht allgemeingültig beantwortet werden.<br />
– Liegen nicht nur aktuelle, sondern auch historische soziodemographische Daten vor,<br />
anhand derer die Clustereinteilung vorgenommen werden könnte? Hierbei ist festzuhalten,<br />
dass der Abstand zwischen den (mindestens zwei) betrachteten Zeitpunkten mit<br />
Vorliebe grösser als bloss ein Jahr sein sollte, da Bewegungen in einem solch kurzen<br />
Zeitraum rein zufällig sein könnten bzw. auch gar nicht erst auftreten.<br />
Die in diesem Abschnitt 6.2.2 dargestellte Landkarte der Kundenlandschaft sowie die darin<br />
enthaltenen Entwicklungspfade sind das Grundgerüst des <strong>Relationship</strong> <strong>Equity</strong> Modells. Es<br />
handelt sich dabei um einen Versuch, das Leben der Bankkunden in einem theoretischen<br />
Modell darzustellen. Während diese Basis noch nicht ausreicht, um Kundenbewertungen<br />
vorzunehmen, könnte sie dennoch schon für das Bankmanagement wie auch einzelne Kundenberater<br />
einen Mehrwert bringen: Als Bewusstmachung des Kundenlebenszyklus könnte<br />
dieser „Blueprint“ <strong>im</strong> Rahmen von Schulungen zur Sensibilisierung auf unterschiedliche<br />
Kundenentwicklungspfade eingesetzt werden. Schon die konsequente Verbreitung solchen<br />
Wissens könnte die langfristig wertmax<strong>im</strong>ale Kundenbearbeitung positiv unterstützen.<br />
6.2.3 Überblick über die Berechnungsschritte<br />
Nachdem die statische Auslegeordnung des Modells und der Inputdaten gemacht worden<br />
ist, soll der Fokus nun auf die Dynamik des Modells, also die ausgeführten Berechnungen<br />
und Transformationen gelegt werden. Diese folgen der in Abbildung 6-5 dargelegten Logik.<br />
6.2.3.1 Berechnungsschritt 1: Familienlogik 1<br />
Da die Lebenszyklusmodellierung auf dem Lebenslauf einzelner Personen aufbaut, stellt<br />
sich dann ein grundsätzliches Berechnungsproblem, wenn sich eine Kontobeziehung auf<br />
mehrere Personen bezieht. Ein typisches Beispiel wäre ein Ehepaar mit gemeinsamer Bankverbindung,<br />
aber zu grossen Teilen unterschiedlichen soziodemographischen Profilen und<br />
mutmasslichen Entwicklungspfaden: In der Lebensgemeinschaft einer praktizierenden<br />
Rechtsanwältin und ihrem angetrauten Gatten, einem „Hausmann“, deren beider Konti aus<br />
historischen Gründen auf den Mann lauten, ist dennoch anzunehmen, dass deren gemeinsame<br />
Entwicklung zu grossen Teilen durch die berufliche Entwicklung der Frau best<strong>im</strong>mt<br />
wird. Das Modell sollte sich demnach prioritär an deren mutmasslichem Entwicklungspfad<br />
ausrichten.<br />
Aus diesem Grund besteht <strong>im</strong> Sinne des Bundesamtes für <strong>St</strong>atistik die Möglichkeit, die<br />
Hauptperson eines Haushalts aufgrund des grössten Erwerbsbeitrags zum gesamten Haus-<br />
166