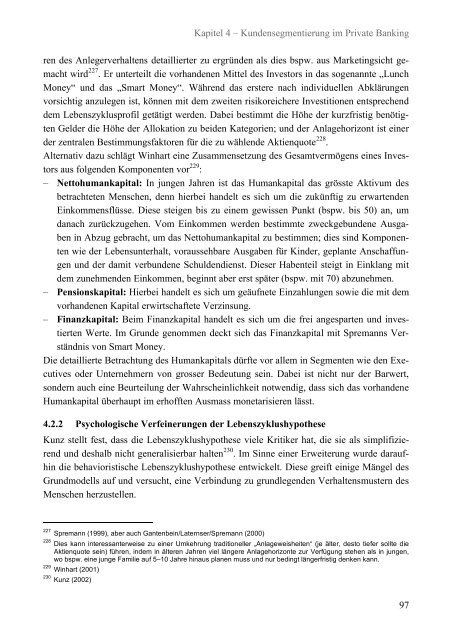Relationship Equity im Private Banking - Universität St.Gallen
Relationship Equity im Private Banking - Universität St.Gallen
Relationship Equity im Private Banking - Universität St.Gallen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Kapitel 4 – Kundensegmentierung <strong>im</strong> <strong>Private</strong> <strong>Banking</strong><br />
ren des Anlegerverhaltens detaillierter zu ergründen als dies bspw. aus Marketingsicht gemacht<br />
wird 227 . Er unterteilt die vorhandenen Mittel des Investors in das sogenannte „Lunch<br />
Money“ und das „Smart Money“. Während das erstere nach individuellen Abklärungen<br />
vorsichtig anzulegen ist, können mit dem zweiten risikoreichere Investitionen entsprechend<br />
dem Lebenszyklusprofil getätigt werden. Dabei best<strong>im</strong>mt die Höhe der kurzfristig benötigten<br />
Gelder die Höhe der Allokation zu beiden Kategorien; und der Anlagehorizont ist einer<br />
der zentralen Best<strong>im</strong>mungsfaktoren für die zu wählende Aktienquote 228 .<br />
Alternativ dazu schlägt Winhart eine Zusammensetzung des Gesamtvermögens eines Investors<br />
aus folgenden Komponenten vor 229 :<br />
– Nettohumankapital: In jungen Jahren ist das Humankapital das grösste Aktivum des<br />
betrachteten Menschen, denn hierbei handelt es sich um die zukünftig zu erwartenden<br />
Einkommensflüsse. Diese steigen bis zu einem gewissen Punkt (bspw. bis 50) an, um<br />
danach zurückzugehen. Vom Einkommen werden best<strong>im</strong>mte zweckgebundene Ausgaben<br />
in Abzug gebracht, um das Nettohumankapital zu best<strong>im</strong>men; dies sind Komponenten<br />
wie der Lebensunterhalt, voraussehbare Ausgaben für Kinder, geplante Anschaffungen<br />
und der damit verbundene Schuldendienst. Dieser Habenteil steigt in Einklang mit<br />
dem zunehmenden Einkommen, beginnt aber erst später (bspw. mit 70) abzunehmen.<br />
– Pensionskapital: Hierbei handelt es sich um geäufnete Einzahlungen sowie die mit dem<br />
vorhandenen Kapital erwirtschaftete Verzinsung.<br />
– Finanzkapital: Be<strong>im</strong> Finanzkapital handelt es sich um die frei angesparten und investierten<br />
Werte. Im Grunde genommen deckt sich das Finanzkapital mit Spremanns Verständnis<br />
von Smart Money.<br />
Die detaillierte Betrachtung des Humankapitals dürfte vor allem in Segmenten wie den Executives<br />
oder Unternehmern von grosser Bedeutung sein. Dabei ist nicht nur der Barwert,<br />
sondern auch eine Beurteilung der Wahrscheinlichkeit notwendig, dass sich das vorhandene<br />
Humankapital überhaupt <strong>im</strong> erhofften Ausmass monetarisieren lässt.<br />
4.2.2 Psychologische Verfeinerungen der Lebenszyklushypothese<br />
Kunz stellt fest, dass die Lebenszyklushypothese viele Kritiker hat, die sie als s<strong>im</strong>plifizierend<br />
und deshalb nicht generalisierbar halten 230 . Im Sinne einer Erweiterung wurde daraufhin<br />
die behavioristische Lebenszyklushypothese entwickelt. Diese greift einige Mängel des<br />
Grundmodells auf und versucht, eine Verbindung zu grundlegenden Verhaltensmustern des<br />
Menschen herzustellen.<br />
227 Spremann (1999), aber auch Gantenbein/Laternser/Spremann (2000)<br />
228 Dies kann interessanterweise zu einer Umkehrung traditioneller „Anlageweisheiten“ (je älter, desto tiefer sollte die<br />
Aktienquote sein) führen, indem in älteren Jahren viel längere Anlagehorizonte zur Verfügung stehen als in jungen,<br />
wo bspw. eine junge Familie auf 5–10 Jahre hinaus planen muss und nur bedingt längerfristig denken kann.<br />
229 Winhart (2001)<br />
230 Kunz (2002)<br />
97