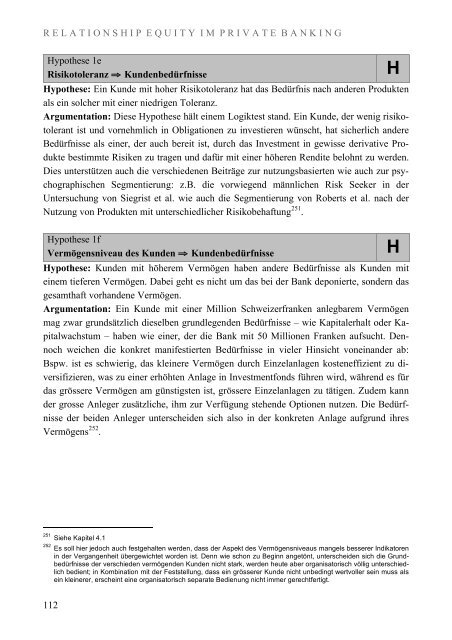Relationship Equity im Private Banking - Universität St.Gallen
Relationship Equity im Private Banking - Universität St.Gallen
Relationship Equity im Private Banking - Universität St.Gallen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
R E L A T I O N S H I P E Q U I T Y I M P R I V A T E B A N K I N G<br />
Hypothese 1e<br />
Risikotoleranz ⇒ Kundenbedürfnisse<br />
Hypothese: Ein Kunde mit hoher Risikotoleranz hat das Bedürfnis nach anderen Produkten<br />
als ein solcher mit einer niedrigen Toleranz.<br />
Argumentation: Diese Hypothese hält einem Logiktest stand. Ein Kunde, der wenig risikotolerant<br />
ist und vornehmlich in Obligationen zu investieren wünscht, hat sicherlich andere<br />
Bedürfnisse als einer, der auch bereit ist, durch das Investment in gewisse derivative Produkte<br />
best<strong>im</strong>mte Risiken zu tragen und dafür mit einer höheren Rendite belohnt zu werden.<br />
Dies unterstützen auch die verschiedenen Beiträge zur nutzungsbasierten wie auch zur psychographischen<br />
Segmentierung: z.B. die vorwiegend männlichen Risk Seeker in der<br />
Untersuchung von Siegrist et al. wie auch die Segmentierung von Roberts et al. nach der<br />
Nutzung von Produkten mit unterschiedlicher Risikobehaftung 251 .<br />
H<br />
Hypothese 1f<br />
Vermögensniveau des Kunden ⇒ Kundenbedürfnisse<br />
Hypothese: Kunden mit höherem Vermögen haben andere Bedürfnisse als Kunden mit<br />
einem tieferen Vermögen. Dabei geht es nicht um das bei der Bank deponierte, sondern das<br />
gesamthaft vorhandene Vermögen.<br />
Argumentation: Ein Kunde mit einer Million Schweizerfranken anlegbarem Vermögen<br />
mag zwar grundsätzlich dieselben grundlegenden Bedürfnisse – wie Kapitalerhalt oder Kapitalwachstum<br />
– haben wie einer, der die Bank mit 50 Millionen Franken aufsucht. Dennoch<br />
weichen die konkret manifestierten Bedürfnisse in vieler Hinsicht voneinander ab:<br />
Bspw. ist es schwierig, das kleinere Vermögen durch Einzelanlagen kosteneffizient zu diversifizieren,<br />
was zu einer erhöhten Anlage in Investmentfonds führen wird, während es für<br />
das grössere Vermögen am günstigsten ist, grössere Einzelanlagen zu tätigen. Zudem kann<br />
der grosse Anleger zusätzliche, ihm zur Verfügung stehende Optionen nutzen. Die Bedürfnisse<br />
der beiden Anleger unterscheiden sich also in der konkreten Anlage aufgrund ihres<br />
Vermögens 252 .<br />
H<br />
251 Siehe Kapitel 4.1<br />
252 Es soll hier jedoch auch festgehalten werden, dass der Aspekt des Vermögensniveaus mangels besserer Indikatoren<br />
in der Vergangenheit übergewichtet worden ist. Denn wie schon zu Beginn angetönt, unterscheiden sich die Grundbedürfnisse<br />
der verschieden vermögenden Kunden nicht stark, werden heute aber organisatorisch völlig unterschiedlich<br />
bedient; in Kombination mit der Feststellung, dass ein grösserer Kunde nicht unbedingt wertvoller sein muss als<br />
ein kleinerer, erscheint eine organisatorisch separate Bedienung nicht <strong>im</strong>mer gerechtfertigt.<br />
112