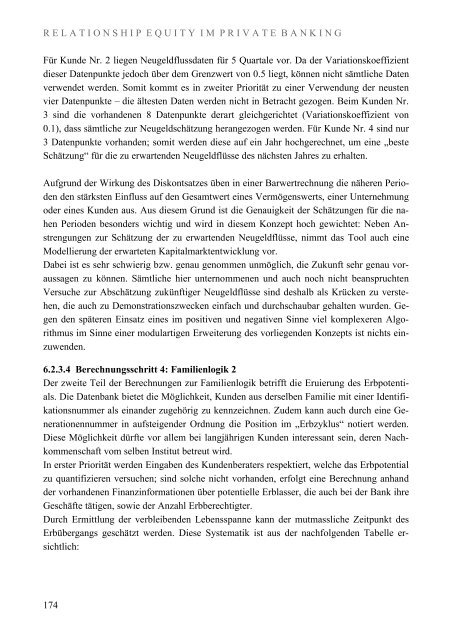Relationship Equity im Private Banking - Universität St.Gallen
Relationship Equity im Private Banking - Universität St.Gallen
Relationship Equity im Private Banking - Universität St.Gallen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
R E L A T I O N S H I P E Q U I T Y I M P R I V A T E B A N K I N G<br />
Für Kunde Nr. 2 liegen Neugeldflussdaten für 5 Quartale vor. Da der Variationskoeffizient<br />
dieser Datenpunkte jedoch über dem Grenzwert von 0.5 liegt, können nicht sämtliche Daten<br />
verwendet werden. Somit kommt es in zweiter Priorität zu einer Verwendung der neusten<br />
vier Datenpunkte – die ältesten Daten werden nicht in Betracht gezogen. Be<strong>im</strong> Kunden Nr.<br />
3 sind die vorhandenen 8 Datenpunkte derart gleichgerichtet (Variationskoeffizient von<br />
0.1), dass sämtliche zur Neugeldschätzung herangezogen werden. Für Kunde Nr. 4 sind nur<br />
3 Datenpunkte vorhanden; somit werden diese auf ein Jahr hochgerechnet, um eine „beste<br />
Schätzung“ für die zu erwartenden Neugeldflüsse des nächsten Jahres zu erhalten.<br />
Aufgrund der Wirkung des Diskontsatzes üben in einer Barwertrechnung die näheren Perioden<br />
den stärksten Einfluss auf den Gesamtwert eines Vermögenswerts, einer Unternehmung<br />
oder eines Kunden aus. Aus diesem Grund ist die Genauigkeit der Schätzungen für die nahen<br />
Perioden besonders wichtig und wird in diesem Konzept hoch gewichtet: Neben Anstrengungen<br />
zur Schätzung der zu erwartenden Neugeldflüsse, n<strong>im</strong>mt das Tool auch eine<br />
Modellierung der erwarteten Kapitalmarktentwicklung vor.<br />
Dabei ist es sehr schwierig bzw. genau genommen unmöglich, die Zukunft sehr genau voraussagen<br />
zu können. Sämtliche hier unternommenen und auch noch nicht beanspruchten<br />
Versuche zur Abschätzung zukünftiger Neugeldflüsse sind deshalb als Krücken zu verstehen,<br />
die auch zu Demonstrationszwecken einfach und durchschaubar gehalten wurden. Gegen<br />
den späteren Einsatz eines <strong>im</strong> positiven und negativen Sinne viel komplexeren Algorithmus<br />
<strong>im</strong> Sinne einer modulartigen Erweiterung des vorliegenden Konzepts ist nichts einzuwenden.<br />
6.2.3.4 Berechnungsschritt 4: Familienlogik 2<br />
Der zweite Teil der Berechnungen zur Familienlogik betrifft die Eruierung des Erbpotentials.<br />
Die Datenbank bietet die Möglichkeit, Kunden aus derselben Familie mit einer Identifikationsnummer<br />
als einander zugehörig zu kennzeichnen. Zudem kann auch durch eine Generationennummer<br />
in aufsteigender Ordnung die Position <strong>im</strong> „Erbzyklus“ notiert werden.<br />
Diese Möglichkeit dürfte vor allem bei langjährigen Kunden interessant sein, deren Nachkommenschaft<br />
vom selben Institut betreut wird.<br />
In erster Priorität werden Eingaben des Kundenberaters respektiert, welche das Erbpotential<br />
zu quantifizieren versuchen; sind solche nicht vorhanden, erfolgt eine Berechnung anhand<br />
der vorhandenen Finanzinformationen über potentielle Erblasser, die auch bei der Bank ihre<br />
Geschäfte tätigen, sowie der Anzahl Erbberechtigter.<br />
Durch Ermittlung der verbleibenden Lebensspanne kann der mutmassliche Zeitpunkt des<br />
Erbübergangs geschätzt werden. Diese Systematik ist aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich:<br />
174