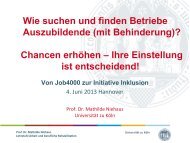Lebenslagen in Deutschland - Bundesministerium für Arbeit und ...
Lebenslagen in Deutschland - Bundesministerium für Arbeit und ...
Lebenslagen in Deutschland - Bundesministerium für Arbeit und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Die Wirkungen der <strong>in</strong>dividuellen Eigenschaften auf die Aufstiegsdynamik entfalten sich vor<br />
allem vermittelt über die (Wieder-) E<strong>in</strong>stiegchancen <strong>in</strong> Erwerbstätigkeit, das erzielte Erwerbse<strong>in</strong>kommen<br />
sowie die Haushaltskonstellation. Die <strong>in</strong>dividuelle Bildung gilt als zentrale<br />
Ressource <strong>für</strong> die soziale Platzierung (Geißler 2011: 280ff.). Mit steigendem Bildungsniveau<br />
ist <strong>für</strong> beide Geschlechter e<strong>in</strong> <strong>in</strong>sgesamt deutlicher Anstieg der Austrittsrate erkennbar. Besonders<br />
schlechte Aufstiegschancen haben Frauen <strong>und</strong> – noch deutlicher – Männer, die ke<strong>in</strong>en<br />
allgeme<strong>in</strong>bildenden (8% bzw. 3%) oder ke<strong>in</strong>en beruflichen Abschluss (17% bzw. 10%) erworben<br />
haben. Hohe Austrittsraten weisen Männer mit berufsbildendem Abschluss (22%)<br />
oder Frauen mit (Fach-) Hochschulabschluss auf (27%). Auch dem Zuwanderungsstatus<br />
kommt e<strong>in</strong>e Bedeutung zu. Für Personen mit direktem Migrationsh<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> (15% bzw.<br />
13%) <strong>und</strong> Frauen mit <strong>in</strong>direktem Migrationsh<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> (12%) lässt sich e<strong>in</strong>e leicht ger<strong>in</strong>gere<br />
Austrittsrate feststellen. Die vergleichsweise ger<strong>in</strong>geren Aufstiegschancen ergeben sich durch<br />
kumulierte Risikofaktoren. Zu diesen Faktoren zählen die niedrigen Schul- <strong>und</strong> Berufsabschlüsse,<br />
k<strong>in</strong>derreiche Haushalte <strong>und</strong> ger<strong>in</strong>gere Chancen auf dem deutschen <strong>Arbeit</strong>smarkt<br />
(Geißler 2011: 245ff.). Für die Aufwärtsmobilität ist zudem der <strong>in</strong>dividuelle Ges<strong>und</strong>heitszustand<br />
von besonderer Bedeutung. Der Zusammenhang zwischen schlechter Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong><br />
ger<strong>in</strong>ger Austrittsrate ist deutlich zu erkennen (11% bzw. 8%). Dieser lässt sich aus den<br />
schlechteren E<strong>in</strong>stiegschancen <strong>in</strong> Erwerbstätigkeit <strong>für</strong> Personen mit ges<strong>und</strong>heitlichen E<strong>in</strong>schränkungen<br />
ableiten (Gangl 1998). Für Personen mit ALG-II-Langzeitbezug ist e<strong>in</strong>e deutlich<br />
ger<strong>in</strong>gere Austrittsrate (13% bzw. 12%) als <strong>für</strong> kurzzeitige Bezieher zu erkennen. Und<br />
auch zwischen den Haushalttypen unterscheiden sich die Abgangsraten. Gegenüber Paarhaushalten<br />
weisen Alle<strong>in</strong>stehende (13% bzw. 14%) <strong>und</strong> alle<strong>in</strong>erziehende Frauen (12%) e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>gere<br />
Aufwärtsmobilität auf. Diese Unterschiede lassen sich vor allem durch die Erwerbsmöglichkeiten<br />
erklären. Die Erwerbsmöglichkeit von Personen hängen sehr wesentlich davon ab,<br />
ob e<strong>in</strong> Partner im Haushalt lebt, ob K<strong>in</strong>der zu versorgen s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> wie Erwerbs- <strong>und</strong> Familienarbeit<br />
auf die im Haushalt lebenden Erwerbsfähigen verteilt wird. Der E<strong>in</strong>fluss der Haushaltskonstellation<br />
auf <strong>Arbeit</strong>smarktübergänge wird <strong>in</strong> zahlreichen Studien kontrolliert (z.B.<br />
Gebauer <strong>und</strong> Vobruba 2003, Wilde 2003). Die Besonderheit von Haushalten mit nur e<strong>in</strong>em<br />
erwachsenen Mitglied ist, dass <strong>in</strong> diesen Haushalten nur e<strong>in</strong> Erwerbse<strong>in</strong>kommen erzielt werden<br />
kann. Dies stellt e<strong>in</strong>e besonders problematische Situation <strong>für</strong> Alle<strong>in</strong>erziehende dar, weil<br />
die Aufgaben der Erziehung, Betreuung <strong>und</strong> Versorgung der K<strong>in</strong>der durch nur e<strong>in</strong>e Person<br />
geleistet werden müssen. Es stellt sich hier also das Problem e<strong>in</strong>es vergrößerten E<strong>in</strong>kommensbedarfs<br />
bei gleichzeitiger Restriktion beim <strong>Arbeit</strong>sangebot aufgr<strong>und</strong> der Notwendigkeit<br />
der K<strong>in</strong>derbetreuung. Alle<strong>in</strong>erziehenden-Haushalte stellen daher e<strong>in</strong>e besondere Risikogruppe<br />
dar, bei der die ger<strong>in</strong>ge E<strong>in</strong>kommensmobilität das Risiko langdauernder Armutsphasen steigert.<br />
Bei den Alle<strong>in</strong>erziehenden lohnt sich e<strong>in</strong> Blick auf Unterschiede nach Wohnregionen<br />
(Ergebnisse nicht dargestellt). Während <strong>in</strong> Westdeutschland die Austrittsrate der alle<strong>in</strong>erziehenden<br />
Frauen bei 10% liegt, beträgt sie bei den alle<strong>in</strong>erziehenden Frauen <strong>in</strong> Ostdeutschland<br />
16%. In Paarhaushalten leben meist m<strong>in</strong>destens zwei erwerbsfähige Personen. Dieser Haushaltstyp<br />
weist aufgr<strong>und</strong> der weiteren potentiellen Erwerbse<strong>in</strong>kommen e<strong>in</strong>e hohe E<strong>in</strong>kom-<br />
160




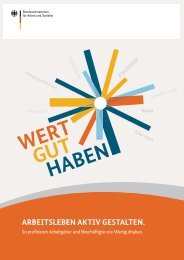
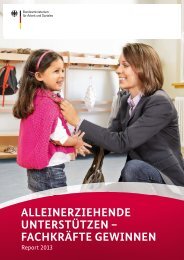



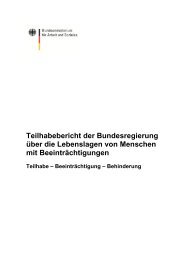
![Begründung zum Referentenentwurf [PDF, 98KB]](https://img.yumpu.com/23386636/1/184x260/begrundung-zum-referentenentwurf-pdf-98kb.jpg?quality=85)