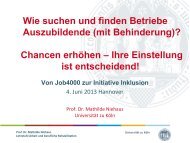Lebenslagen in Deutschland - Bundesministerium für Arbeit und ...
Lebenslagen in Deutschland - Bundesministerium für Arbeit und ...
Lebenslagen in Deutschland - Bundesministerium für Arbeit und ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Abbildung 106: Wahl der Gesellschaftsbilder (<strong>in</strong> %)<br />
76%<br />
21%<br />
3%<br />
Daten: Sozialstaatliche Transformation, 2008<br />
In der vorliegenden Studie wählen drei Viertel der Befragten die größte Form der Ungleichheit<br />
<strong>und</strong> ca. e<strong>in</strong> Fünftel die klassische Zwiebel aus dem Sozialk<strong>und</strong>eunterricht, e<strong>in</strong>e Mittelstandsgesellschaft<br />
mit wenigen Menschen am oberen <strong>und</strong> unteren Rand 65 . Nur e<strong>in</strong>e verschw<strong>in</strong>dend<br />
ger<strong>in</strong>ge M<strong>in</strong>derheit (ca. 3 Prozent) sieht ebenso viele Menschen an der ökonomischen<br />
Spitze wie auf den untersten Rängen der Gesellschaft. Dieser Gesamte<strong>in</strong>druck e<strong>in</strong>er<br />
sehr ungleichen Verteilung von Armut <strong>und</strong> Reichtum unterscheidet sich kaum nach der tatsächlichen<br />
sozialen Position der Befragten, der Wohnregion oder dem Geschlecht. Männer<br />
wie Frauen, Ostdeutsche wie Westdeutsche, Junge wie Alte, Empfänger/-<strong>in</strong>nen von Leistungen<br />
aus SGB II ebenso wie Erwerbstätige – alle sehen <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie im Dreieck die aktuelle<br />
B<strong>und</strong>esrepublik repräsentiert. Die Gruppen unterscheiden sich lediglich dar<strong>in</strong> wie groß der<br />
Anteil jener ist, die sich <strong>für</strong> das Dreieck entscheiden.<br />
Aus der E<strong>in</strong>stellungsforschung wissen wir, dass Bevölkerungsgruppen, die von der<br />
Verteilung von Privilegien <strong>und</strong> Ressourcen begünstigt s<strong>in</strong>d, dazu tendieren soziale Ungleichheiten<br />
weniger kritisch zu beurteilen als benachteiligte Gruppen (Noll/Christoph 2004; Hochschild<br />
2000). Auch <strong>in</strong> den vorliegenden Daten wird diese Tendenz deutlich. So entscheiden<br />
sich nicht erwerbstätige Männer <strong>und</strong> Frauen sowie Empfänger von <strong>Arbeit</strong>slosengeld I oder II<br />
häufiger <strong>für</strong> das Dreieck, als Erwerbstätige. Dies gilt <strong>für</strong> Männer ebenso wie <strong>für</strong> Frauen. Auch<br />
Personen aus der unteren E<strong>in</strong>kommensgruppe 66 sehen besonders häufig diese ungleiche Form<br />
65 Dies entspricht auch der aktuellen ALLBUS-Erhebung aus dem Jahr 2010. Auch hier wurden verschiedene<br />
Verteilungsformen zur Wahl gestellt, allerd<strong>in</strong>gs <strong>in</strong>sgesamt sechs Figuren. Dabei entscheiden sich 36 Prozent der<br />
Befragten <strong>für</strong> das Dreieck <strong>und</strong> weitere 42 Prozent <strong>für</strong> e<strong>in</strong>e Dreiecksvariation, so dass auch hier 78 Prozent e<strong>in</strong>e<br />
solch große Ungleichheit wahrnehmen. Im ALLBUS wählen weitere 18 Prozent die Zwiebelform <strong>und</strong> 4 Prozent<br />
entscheiden sich <strong>für</strong> e<strong>in</strong> auf dem Kopf stehendes Dreieck. (ALLBUS 2010, eigene Berechnung)<br />
66 Die drei E<strong>in</strong>kommensgruppen (auch E<strong>in</strong>kommenssichten genannt) s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Anlehnung an Goebel et al. (2010:<br />
3) wie folgt def<strong>in</strong>iert: Oben - Personen deren Nettoäquivalenze<strong>in</strong>kommen höher ist als 150 Prozent des mittleren<br />
(Median) Nettoäquivalenze<strong>in</strong>kommens der Bevölkerung zum Befragungszeitpunkt; Mitte - 70 bis 150 Prozent<br />
<strong>und</strong> Unten weniger als 70 Prozent. (siehe auch Anhang) Diese Unterteilung dient der Unterscheidung von E<strong>in</strong>kommensgruppen.<br />
Wir streben nicht danach auf diesem Wege „Schichten“ zu def<strong>in</strong>ieren, denn dazu wären neben<br />
dem E<strong>in</strong>kommen auch andere Merkmale notwendig. Für e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>kommensgruppierung s<strong>in</strong>d verschiedene<br />
Grenzsetzungen möglich. Die am weitesten verbreiteten Grenzziehungen bewegen sich im Rahmen der hier<br />
gewählten Version (siehe z.B. Grabka/Frick 2008).<br />
242




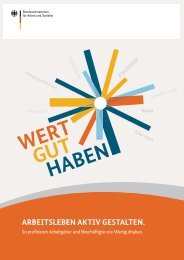
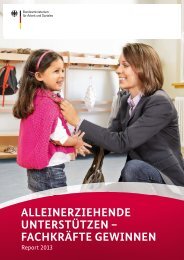



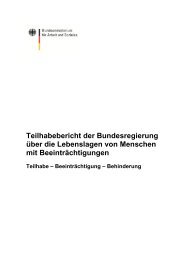
![Begründung zum Referentenentwurf [PDF, 98KB]](https://img.yumpu.com/23386636/1/184x260/begrundung-zum-referentenentwurf-pdf-98kb.jpg?quality=85)