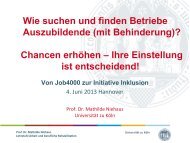Lebenslagen in Deutschland - Bundesministerium für Arbeit und ...
Lebenslagen in Deutschland - Bundesministerium für Arbeit und ...
Lebenslagen in Deutschland - Bundesministerium für Arbeit und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
chen Situation stark veränderlich (Heitmeyer 2009: 29) Wie Willhelm Heitmeyer zeigen<br />
kann, wird die Bewertung der eigenen wirtschaftlichen Lage zwar tendenziell durch die Bewertung<br />
der Gesamtsituation bee<strong>in</strong>flusst <strong>und</strong> der negativen Gesamte<strong>in</strong>schätzung folgt zeitverzögert<br />
auch e<strong>in</strong>e schlechtere E<strong>in</strong>schätzung der eigenen Lage. jedoch ist dieser Effekt nicht<br />
sonderlich groß (Heitmeyer 2009: 29). Heitmeyer vermutet h<strong>in</strong>ter dieser Aufspaltung den<br />
Versuch, die eigene Angst abzubauen, von der als negativ empf<strong>und</strong>en Gesamtentwicklung<br />
mitgerissen zu werden. Die Menschen schützen sich <strong>und</strong> streben danach, e<strong>in</strong>e positive Identität<br />
aufrecht zu erhalten (Tajfel/Turner <strong>in</strong> Schiffmann/ Wickl<strong>und</strong> 1988). In diesem Zusammenhang<br />
hilft auch der Vergleich „nach unten“, der Vergleich mit Menschen, denen es noch<br />
schlechter geht (Sachweh 2010: 43). E<strong>in</strong> anderer Mechanismus e<strong>in</strong>es solchen Selbstschutzes<br />
besteht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>ternalen Kontrollüberzeugung, der Ansicht also, das eigene Leben unter<br />
Kontrolle zu haben, den eigenen Lebensweg durch bestimmte Verhaltensweisen aktiv gestalten<br />
zu können (Heitmeyer 2009: 28). So ist <strong>in</strong> den Augen der meisten Menschen <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong><br />
neben e<strong>in</strong>er „guten Ausbildung“ vor allem „harte <strong>Arbeit</strong>“ <strong>und</strong> „Ehrgeiz“ notwendig, um<br />
„im Leben vorwärts zu kommen“. Im Vergleich dazu gestehen nur wenige Menschen solchen<br />
Merkmalen e<strong>in</strong>e wichtige Bedeutung zu, die durch den E<strong>in</strong>zelnen nicht bee<strong>in</strong>flusst werden<br />
können, wie der Nationalität/Herkunft oder dem Geschlecht e<strong>in</strong>er Person. Vor diese H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong><br />
verw<strong>und</strong>ert es auch nicht, dass e<strong>in</strong> Großteil der Bevölkerung der Ansicht ist soziale<br />
Positionen sollten <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie <strong>in</strong> Abhängigkeit von der Leistung des E<strong>in</strong>zelnen verteilt<br />
werden.<br />
Dennoch ist dies e<strong>in</strong> oberflächlicher Blick auf die Wahrnehmung der Menschen. Zwar<br />
be<strong>für</strong>worten die meisten Menschen den Tausch von <strong>in</strong>dividueller Leistung gegen gesellschaftliche<br />
Teilhabe (Leistungsgerechtigkeit), jedoch s<strong>in</strong>d viele derselben Menschen auch der Ansicht,<br />
dass das E<strong>in</strong>kommen nicht nur an der Leistung des E<strong>in</strong>zelnen, sondern auch an dessen<br />
Bedarf bemessen se<strong>in</strong> soll. Des Weiteren können wir auf Gr<strong>und</strong>lage der standardisierten Abfrage<strong>in</strong>strumente,<br />
wie sie etwa im ALLBUS vorliegen, nicht sagen, was genau die Befragten<br />
jeweils unter „Leistung“ verstehen. Neckel/Dröge/Somm (2005) zeigen anhand von Gruppendiskussionen,<br />
dass „Leistung“ <strong>und</strong> „Leistungsgerechtigkeit“ <strong>in</strong> verschiedenen sozialen Gruppen<br />
mit je anderen Vorstellungen verknüpft ist. Personen aus unteren sozialen Schichten verb<strong>in</strong>den<br />
Leistung <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>e mit der diszipl<strong>in</strong>ierten Erledigung von Aufgaben <strong>und</strong> weniger<br />
mit <strong>Arbeit</strong>sergebnissen <strong>und</strong> deren Darstellung (Neckel/Dröge/Somm 2005 bei Sachweh 2010:<br />
70). In diesem S<strong>in</strong>ne hat es den Ansche<strong>in</strong>, dass viele Menschen e<strong>in</strong>e bedarfsorientierte Gr<strong>und</strong>sicherung<br />
be<strong>für</strong>worten auf der aufbauend dann jeder <strong>und</strong> jede durch Bemühen <strong>und</strong> Leistung<br />
das eigene Leben gestalten kann. Dabei ist die Bevölkerung nicht bl<strong>in</strong>d <strong>für</strong> existierende Ungleichheiten<br />
<strong>und</strong> Barrieren. So erkennt z.B. die Hälfte der Bevölkerung den Fakt an, dass auch<br />
die nicht <strong>in</strong>dividuell steuerbare Merkmale wie die Herkunft aus e<strong>in</strong>em gebildeten Elternhaus<br />
den eigenen Lebensweg entscheidend bee<strong>in</strong>flusst. Davon abgesehen zeigen sich zwar Verweise<br />
auf e<strong>in</strong>e unterschiedliche Wahrnehmung der privaten <strong>und</strong> der gesellschaftlichen Sphäre,<br />
jedoch werden <strong>in</strong> der Beurteilung der eigenen Lebenslage Ungleichheiten nicht vollkommen<br />
ignoriert. E<strong>in</strong>drucksvoll zeigt sich dies im Vergleich der subjektiven Positionen von Erwerbs-<br />
290




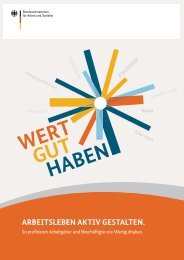
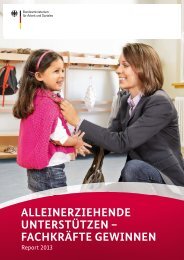



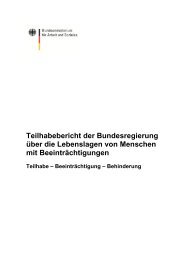
![Begründung zum Referentenentwurf [PDF, 98KB]](https://img.yumpu.com/23386636/1/184x260/begrundung-zum-referentenentwurf-pdf-98kb.jpg?quality=85)