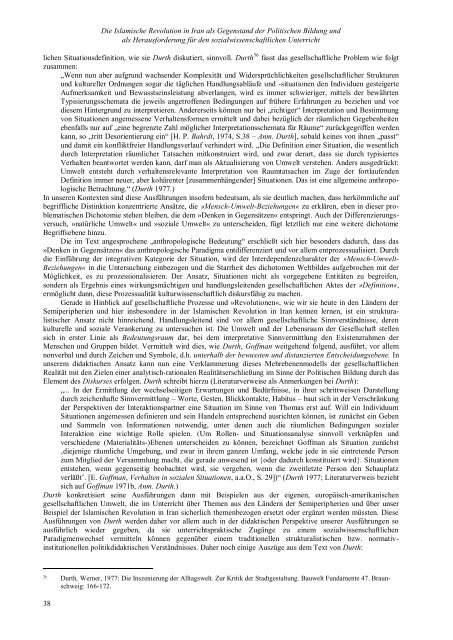Die Islamische Revolution in Iran als Gegenstand der Politischen ...
Die Islamische Revolution in Iran als Gegenstand der Politischen ...
Die Islamische Revolution in Iran als Gegenstand der Politischen ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Die</strong> <strong>Islamische</strong> <strong>Revolution</strong> <strong>in</strong> <strong>Iran</strong> <strong>als</strong> <strong>Gegenstand</strong> <strong>der</strong> <strong>Politischen</strong> Bildung und<br />
<strong>als</strong> Herausfor<strong>der</strong>ung für den sozialwissenschaftlichen Unterricht<br />
lichen Situationsdef<strong>in</strong>ition, wie sie Durth diskutiert, s<strong>in</strong>nvoll. Durth 56 fasst das gesellschaftliche Problem wie folgt<br />
zusammen:<br />
„Wenn nun aber aufgrund wachsen<strong>der</strong> Komplexität und Wi<strong>der</strong>sprüchlichkeiten gesellschaftlicher Strukturen<br />
und kultureller Ordnungen sogar die täglichen Handlungsabläufe und -situationen den Individuen gesteigerte<br />
Aufmerksamkeit und Bewusstse<strong>in</strong>sleistung abverlangen, wird es immer schwieriger, mittels <strong>der</strong> bewährten<br />
Typisierungsschemata die jeweils angetroffenen Bed<strong>in</strong>gungen auf frühere Erfahrungen zu beziehen und vor<br />
diesem H<strong>in</strong>tergrund zu <strong>in</strong>terpretieren. An<strong>der</strong>erseits können nur bei „richtiger“ Interpretation und Bestimmung<br />
von Situationen angemessene Verhaltensformen ermittelt und dabei bezüglich <strong>der</strong> räumlichen Gegebenheiten<br />
ebenfalls nur auf „e<strong>in</strong>e begrenzte Zahl möglicher Interpretationsschemata für Räume“ zurückgegriffen werden<br />
kann, so „tritt Desorientierung e<strong>in</strong>“ [H. P. Bahrdt, 1974, S.38 – Anm. Durth], sobald ke<strong>in</strong>es von ihnen „passt“<br />
und damit e<strong>in</strong> konfliktfreier Handlungsverlauf verh<strong>in</strong><strong>der</strong>t wird. „<strong>Die</strong> Def<strong>in</strong>ition e<strong>in</strong>er Situation, die wesentlich<br />
durch Interpretation räumlicher Tatsachen mitkonstruiert wird, und zwar <strong>der</strong>art, dass sie durch typisiertes<br />
Verhalten beantwortet werden kann, darf man <strong>als</strong> Aktualisierung von Umwelt verstehen. An<strong>der</strong>s ausgedrückt:<br />
Umwelt entsteht durch verhaltensrelevante Interpretation von Raumtatsachen im Zuge <strong>der</strong> fortlaufenden<br />
Def<strong>in</strong>ition immer neuer, aber kohärenter [zusammenhängen<strong>der</strong>] Situationen. Das ist e<strong>in</strong>e allgeme<strong>in</strong>e anthropologische<br />
Betrachtung.“ (Durth 1977.)<br />
In unseren Kontexten s<strong>in</strong>d diese Ausführungen <strong>in</strong>sofern bedeutsam, <strong>als</strong> sie deutlich machen, dass herkömmliche auf<br />
begriffliche Dist<strong>in</strong>ktion konzentrierte Ansätze, die »Mensch-Umwelt-Beziehungen« zu erklären, eben <strong>in</strong> dieser problematischen<br />
Dichotomie stehen bleiben, die dem »Denken <strong>in</strong> Gegensätzen« entspr<strong>in</strong>gt. Auch <strong>der</strong> Differenzierungsversuch,<br />
»natürliche Umwelt« und »soziale Umwelt« zu unterscheiden, fügt letztlich nur e<strong>in</strong>e weitere dichotome<br />
Begriffsebene h<strong>in</strong>zu.<br />
<strong>Die</strong> im Text angesprochene „anthropologische Bedeutung“ erschließt sich hier beson<strong>der</strong>s dadurch, dass das<br />
»Denken <strong>in</strong> Gegensätzen« das anthropologische Paradigma entdifferenziert und vor allem entprozessualisiert. Durch<br />
die E<strong>in</strong>führung <strong>der</strong> <strong>in</strong>tegrativen Kategorie <strong>der</strong> Situation, wird <strong>der</strong> Interdependenzcharakter <strong>der</strong> »Mensch-Umwelt-<br />
Beziehungen« <strong>in</strong> die Untersuchung e<strong>in</strong>bezogen und die Starrheit des dichotomen Weltbildes aufgebrochen mit <strong>der</strong><br />
Möglichkeit, es zu prozessionalisieren. Der Ansatz, Situationen nicht <strong>als</strong> vorgegebene Entitäten zu begreifen,<br />
son<strong>der</strong>n <strong>als</strong> Ergebnis e<strong>in</strong>es wirkungsmächtigen und handlungsleitenden gesellschaftlichen Aktes <strong>der</strong> »Def<strong>in</strong>ition«,<br />
ermöglicht dann, diese Prozessualität kulturwissenschaftlich diskursfähig zu machen.<br />
Gerade <strong>in</strong> H<strong>in</strong>blick auf gesellschaftliche Prozesse und »<strong>Revolution</strong>en«, wie wir sie heute <strong>in</strong> den Län<strong>der</strong>n <strong>der</strong><br />
Semiperipherien und hier <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Islamische</strong>n <strong>Revolution</strong> <strong>in</strong> <strong>Iran</strong> kennen lernen, ist e<strong>in</strong> strukturalistischer<br />
Ansatz nicht h<strong>in</strong>reichend. Handlungsleitend s<strong>in</strong>d vor allem gesellschaftliche S<strong>in</strong>nverständnisse, <strong>der</strong>en<br />
kulturelle und soziale Verankerung zu untersuchen ist. <strong>Die</strong> Umwelt und <strong>der</strong> Lebensraum <strong>der</strong> Gesellschaft stellen<br />
sich <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie <strong>als</strong> Bedeutungsraum dar, bei dem <strong>in</strong>terpretative S<strong>in</strong>nvermittlung den Existenzrahmen <strong>der</strong><br />
Menschen und Gruppen bildet. Vermittelt wird dies, wie Durth, Goffman weitgehend folgend, ausführt, vor allem<br />
nonverbal und durch Zeichen und Symbole, d.h. unterhalb <strong>der</strong> bewussten und distanzierten Entscheidungsebene. In<br />
unserem didaktischen Ansatz kann nun e<strong>in</strong>e Verklammerung dieses Mehrebenenmodells <strong>der</strong> gesellschaftlichen<br />
Realität mit den Zielen e<strong>in</strong>er analytisch-rationalen Realitätserschließung im S<strong>in</strong>ne <strong>der</strong> <strong>Politischen</strong> Bildung durch das<br />
Element des Diskurses erfolgen. Durth schreibt hierzu (Literaturverweise <strong>als</strong> Anmerkungen bei Durth):<br />
„... In <strong>der</strong> Ermittlung <strong>der</strong> wechselseitigen Erwartungen und Bedürfnisse, <strong>in</strong> ihrer schrittweisen Darstellung<br />
durch zeichenhafte S<strong>in</strong>nvermittlung – Worte, Gesten, Blickkontakte, Habitus – baut sich <strong>in</strong> <strong>der</strong> Verschränkung<br />
<strong>der</strong> Perspektiven <strong>der</strong> Interaktionspartner e<strong>in</strong>e Situation im S<strong>in</strong>ne von Thomas erst auf. Will e<strong>in</strong> Individuum<br />
Situationen angemessen def<strong>in</strong>ieren und se<strong>in</strong> Handeln entsprechend ausrichten können, ist zunächst e<strong>in</strong> Geben<br />
und Sammeln von Informationen notwendig, unter denen auch die räumlichen Bed<strong>in</strong>gungen sozialer<br />
Interaktion e<strong>in</strong>e wichtige Rolle spielen. (Um Rollen- und Situationsanalyse s<strong>in</strong>nvoll verknüpfen und<br />
verschiedene (Materialitäts-)Ebenen unterscheiden zu können, bezeichnet Goffman <strong>als</strong> Situation zunächst<br />
‚diejenige räumliche Umgebung, und zwar <strong>in</strong> ihrem ganzen Umfang, welche jede <strong>in</strong> sie e<strong>in</strong>tretende Person<br />
zum Mitglied <strong>der</strong> Versammlung macht, die gerade anwesend ist {o<strong>der</strong> dadurch konstituiert wird}. Situationen<br />
entstehen, wenn gegenseitig beobachtet wird, sie vergehen, wenn die zweitletzte Person den Schauplatz<br />
verläßt‛. [E. Goffman, Verhalten <strong>in</strong> sozialen Situationen, a.a.O., S. 29])“ (Durth 1977; Literaturverweis bezieht<br />
sich auf Goffman 1971b, Anm. Durth.)<br />
Durth konkretisiert se<strong>in</strong>e Ausführungen dann mit Beispielen aus <strong>der</strong> eigenen, europäisch-amerikanischen<br />
gesellschaftlichen Umwelt, die im Unterricht über Themen aus den Län<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Semiperipherien und über unser<br />
Beispiel <strong>der</strong> <strong>Islamische</strong>n <strong>Revolution</strong> <strong>in</strong> <strong>Iran</strong> sicherlich themenbezogen ersetzt o<strong>der</strong> ergänzt werden müssten. <strong>Die</strong>se<br />
Ausführungen von Durth werden daher vor allem auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> didaktischen Perspektive unserer Ausführungen so<br />
ausführlich wie<strong>der</strong> gegeben, da sie unterrichtspraktische Zugänge zu e<strong>in</strong>em sozialwissenschaftlichen<br />
Paradigmenwechsel vermitteln können gegenüber e<strong>in</strong>em traditionellen strukturalistischen bzw. normativ<strong>in</strong>stitutionellen<br />
politikdidaktischen Verständnisses. Daher noch e<strong>in</strong>ige Auszüge aus dem Text von Durth:<br />
38<br />
56<br />
Durth, Werner, 1977: <strong>Die</strong> Inszenierung <strong>der</strong> Alltagswelt. Zur Kritik <strong>der</strong> Stadtgestaltung. Bauwelt Fundamente 47. Braunschweig:<br />
166-172.