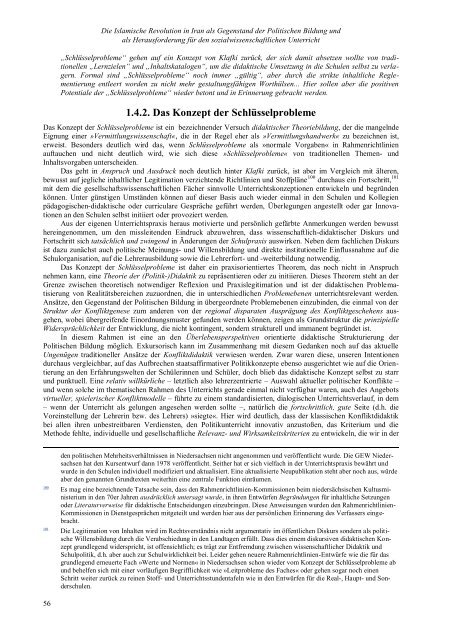Die Islamische Revolution in Iran als Gegenstand der Politischen ...
Die Islamische Revolution in Iran als Gegenstand der Politischen ...
Die Islamische Revolution in Iran als Gegenstand der Politischen ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Die</strong> <strong>Islamische</strong> <strong>Revolution</strong> <strong>in</strong> <strong>Iran</strong> <strong>als</strong> <strong>Gegenstand</strong> <strong>der</strong> <strong>Politischen</strong> Bildung und<br />
<strong>als</strong> Herausfor<strong>der</strong>ung für den sozialwissenschaftlichen Unterricht<br />
„Schlüsselprobleme“ gehen auf e<strong>in</strong> Konzept von Klafki zurück, <strong>der</strong> sich damit absetzen wollte von traditionellen<br />
„Lernzielen“ und „Inhaltskatalogen“, um die didaktische Umsetzung <strong>in</strong> die Schulen selbst zu verlagern.<br />
Formal s<strong>in</strong>d „Schlüsselprobleme“ noch immer „gültig“, aber durch die strikte <strong>in</strong>haltliche Reglementierung<br />
entleert worden zu nicht mehr gestaltungsfähigen Worthülsen... Hier sollen aber die positiven<br />
Potentiale <strong>der</strong> „Schlüsselprobleme“ wie<strong>der</strong> betont und <strong>in</strong> Er<strong>in</strong>nerung gebracht werden.<br />
1.4.2. Das Konzept <strong>der</strong> Schlüsselprobleme<br />
Das Konzept <strong>der</strong> Schlüsselprobleme ist e<strong>in</strong> bezeichnen<strong>der</strong> Versuch didaktischer Theoriebildung, <strong>der</strong> die mangelnde<br />
Eignung e<strong>in</strong>er »Vermittlungswissenschaft«, die <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel eher <strong>als</strong> »Vermittlungshandwerk« zu bezeichnen ist,<br />
erweist. Beson<strong>der</strong>s deutlich wird das, wenn Schlüsselprobleme <strong>als</strong> »normale Vorgaben« <strong>in</strong> Rahmenrichtl<strong>in</strong>ien<br />
auftauchen und nicht deutlich wird, wie sich diese »Schlüsselprobleme« von traditionellen Themen- und<br />
Inhaltsvorgaben unterscheiden.<br />
Das geht <strong>in</strong> Anspruch und Ausdruck noch deutlich h<strong>in</strong>ter Klafki zurück, ist aber im Vergleich mit älteren,<br />
bewusst auf jegliche <strong>in</strong>haltlicher Legitimation verzichtende Richtl<strong>in</strong>ien und Stoffpläne 100 durchaus e<strong>in</strong> Fortschritt, 101<br />
mit dem die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer s<strong>in</strong>nvolle Unterrichtskonzeptionen entwickeln und begründen<br />
können. Unter günstigen Umständen können auf dieser Basis auch wie<strong>der</strong> e<strong>in</strong>mal <strong>in</strong> den Schulen und Kollegien<br />
pädagogischen-didaktische o<strong>der</strong> curriculare Gespräche geführt werden, Überlegungen angestellt o<strong>der</strong> gar Innovationen<br />
an den Schulen selbst <strong>in</strong>itiiert o<strong>der</strong> provoziert werden.<br />
Aus <strong>der</strong> eigenen Unterrichtspraxis heraus motivierte und persönlich gefärbte Anmerkungen werden bewusst<br />
here<strong>in</strong>genommen, um den missleitenden E<strong>in</strong>druck abzuwehren, dass wissenschaftlich-didaktischer Diskurs und<br />
Fortschritt sich tatsächlich und zw<strong>in</strong>gend <strong>in</strong> Än<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Schulpraxis auswirken. Neben dem fachlichen Diskurs<br />
ist dazu zunächst auch politische Me<strong>in</strong>ungs- und Willensbildung und direkte <strong>in</strong>stitutionelle E<strong>in</strong>flussnahme auf die<br />
Schulorganisation, auf die Lehrerausbildung sowie die Lehrerfort- und -weiterbildung notwendig.<br />
Das Konzept <strong>der</strong> Schlüsselprobleme ist daher e<strong>in</strong> praxisorientiertes Theorem, das noch nicht <strong>in</strong> Anspruch<br />
nehmen kann, e<strong>in</strong>e Theorie <strong>der</strong> (Politik-)Didaktik zu repräsentieren o<strong>der</strong> zu <strong>in</strong>itiieren. <strong>Die</strong>ses Theorem steht an <strong>der</strong><br />
Grenze zwischen theoretisch notwendiger Reflexion und Praxislegitimation und ist <strong>der</strong> didaktischen Problematisierung<br />
von Realitätsbereichen zuzuordnen, die <strong>in</strong> unterschiedlichen Problemebenen unterrichtsrelevant werden.<br />
Ansätze, den <strong>Gegenstand</strong> <strong>der</strong> <strong>Politischen</strong> Bildung <strong>in</strong> übergeordnete Problemebenen e<strong>in</strong>zub<strong>in</strong>den, die e<strong>in</strong>mal von <strong>der</strong><br />
Struktur <strong>der</strong> Konfliktgenese zum an<strong>der</strong>en von <strong>der</strong> regional disparaten Ausprägung des Konfliktgeschehens ausgehen,<br />
wobei übergreifende E<strong>in</strong>ordnungsmuster gefunden werden können, zeigen <strong>als</strong> Grundstruktur die pr<strong>in</strong>zipielle<br />
Wi<strong>der</strong>sprüchlichkeit <strong>der</strong> Entwicklung, die nicht kont<strong>in</strong>gent, son<strong>der</strong>n strukturell und immanent begründet ist.<br />
In diesem Rahmen ist e<strong>in</strong>e an den Überlebensperspektiven orientierte didaktische Strukturierung <strong>der</strong><br />
<strong>Politischen</strong> Bildung möglich. Exkursorisch kann im Zusammenhang mit diesem Gedanken noch auf das aktuelle<br />
Ungenügen traditioneller Ansätze <strong>der</strong> Konfliktdidaktik verwiesen werden. Zwar waren diese, unseren Intentionen<br />
durchaus vergleichbar, auf das Aufbrechen staatsaffirmativer Politikkonzepte ebenso ausgerichtet wie auf die Orientierung<br />
an den Erfahrungswelten <strong>der</strong> Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler, doch blieb das didaktische Konzept selbst zu starr<br />
und punktuell. E<strong>in</strong>e relativ willkürliche – letztlich <strong>als</strong>o lehrerzentrierte – Auswahl aktueller politischer Konflikte –<br />
und wenn solche im thematischen Rahmen des Unterrichts gerade e<strong>in</strong>mal nicht verfügbar waren, auch des Angebots<br />
virtueller, spielerischer Konfliktmodelle – führte zu e<strong>in</strong>em standardisierten, dialogischen Unterrichtsverlauf, <strong>in</strong> dem<br />
– wenn <strong>der</strong> Unterricht <strong>als</strong> gelungen angesehen werden sollte –, natürlich die fortschrittlich, gute Seite (d.h. die<br />
Vore<strong>in</strong>stellung <strong>der</strong> Lehrer<strong>in</strong> bzw. des Lehrers) »siegte«. Hier wird deutlich, dass <strong>der</strong> klassischen Konfliktdidaktik<br />
bei allen ihren unbestreitbaren Verdiensten, den Politikunterricht <strong>in</strong>novativ anzustoßen, das Kriterium und die<br />
Methode fehlte, <strong>in</strong>dividuelle und gesellschaftliche Relevanz- und Wirksamkeitskriterien zu entwickeln, die wir <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
100<br />
56<br />
den politischen Mehrheitsverhältnissen <strong>in</strong> Nie<strong>der</strong>sachsen nicht angenommen und veröffentlicht wurde. <strong>Die</strong> GEW Nie<strong>der</strong>sachsen<br />
hat den Kursentwurf dann 1978 veröffentlicht. Seither hat er sich vielfach <strong>in</strong> <strong>der</strong> Unterrichtspraxis bewährt und<br />
wurde <strong>in</strong> den Schulen <strong>in</strong>dividuell modifiziert und aktualisiert. E<strong>in</strong>e aktualisierte Neupublikation steht aber noch aus, würde<br />
aber den genannten Grundtexten weiterh<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e zentrale Funktion e<strong>in</strong>räumen.<br />
Es mag e<strong>in</strong>e bezeichnende Tatsache se<strong>in</strong>, dass den Rahmenrichtl<strong>in</strong>ien-Kommissionen beim nie<strong>der</strong>sächsischen Kultusm<strong>in</strong>isterium<br />
<strong>in</strong> den 70er Jahren ausdrücklich untersagt wurde, <strong>in</strong> ihren Entwürfen Begründungen für <strong>in</strong>haltliche Setzungen<br />
o<strong>der</strong> Literaturverweise für didaktische Entscheidungen e<strong>in</strong>zubr<strong>in</strong>gen. <strong>Die</strong>se Anweisungen wurden den Rahmenrichtl<strong>in</strong>ien-<br />
Kommissionen <strong>in</strong> <strong>Die</strong>nstgesprächen mitgeteilt und werden hier aus <strong>der</strong> persönlichen Er<strong>in</strong>nerung des Verfassers e<strong>in</strong>gebracht.<br />
101<br />
<strong>Die</strong> Legitimation von Inhalten wird im Rechtsverständnis nicht argumentativ im öffentlichen Diskurs son<strong>der</strong>n <strong>als</strong> politische<br />
Willensbildung durch die Verabschiedung <strong>in</strong> den Landtagen erfüllt. Dass dies e<strong>in</strong>em diskursiven didaktischen Konzept<br />
grundlegend wi<strong>der</strong>spricht, ist offensichtlich; es trägt zur Entfremdung zwischen wissenschaftlicher Didaktik und<br />
Schulpolitik, d.h. aber auch zur Schulwirklichkeit bei. Lei<strong>der</strong> gehen neuere Rahmenrichtl<strong>in</strong>ien-Entwürfe wie die für das<br />
grundlegend erneuerte Fach »Werte und Normen« <strong>in</strong> Nie<strong>der</strong>sachsen schon wie<strong>der</strong> vom Konzept <strong>der</strong> Schlüsselprobleme ab<br />
und behelfen sich mit e<strong>in</strong>er vorläufigen Begrifflichkeit wie »Leitprobleme des Faches« o<strong>der</strong> gehen sogar noch e<strong>in</strong>en<br />
Schritt weiter zurück zu re<strong>in</strong>en Stoff- und Unterrichtsstundentafeln wie <strong>in</strong> den Entwürfen für die Real-, Haupt- und Son<strong>der</strong>schulen.